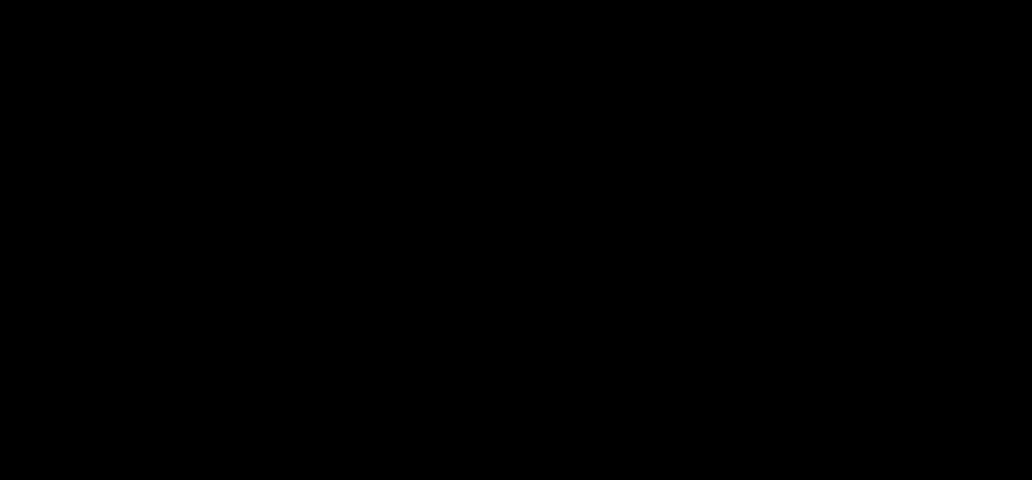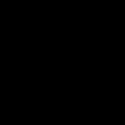Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 27)
Vor der Tür erwartete mich immer noch der Regen, ein feines Gespinst, das erstaunlich wärmend vom Himmel nieselte. Weit musste ich nicht laufen, nur um die Ecke, die George Street zurück, wo es schon bald verlockend nach Frittiertem roch. Mit leicht ozillierenden Ausschlägen spazierte ich auf einen stadtbekannten fish & chips Imbiss zu und nahm mit Schwung die zwei Treppenstufen – hoppla, beinahe wäre ich hinter dem Eingang ausgerutscht und hingefallen. Gleich einem Schmierfilm klebten die Reste von Bratöl nicht nur auf der Rutschbahn von Linoleum, sondern auch an den blauweiß dekorierten Wänden und auf Tischen und Stühlen. Trotz großer fauchender Abzugshauben über fünf sprudelnden Fritteusen war die Raumluft verqualmt und noch lange sollte mein Anorak nach Frittiertem riechen.
In der landesüblichen Garküche bekam der kleine Mann für billig Geld das schottische Standardgericht, für 9,50 Pfund ein im Teigmantel frittiertes Seebarsch-Filet mit einer üppig gefüllten Handschale maschinell geschnitzter Pommes. Mit Appetit aß ich die öltriefende Fischmahlzeit, die nicht nur schmeckte, sondern auch den klitzekleinen Schwips vertrieb. So lief ich eine halbe Stunde später mit vollem Magen und festen Schritts über das rutschige Linoleum und aus dem brechend vollen Laden wieder in den Nieselregen hinaus. Schon lange hatte sich mein Bauch nicht mehr so behaglich und warm angefühlt. Wäre mein Quartier nahe gewesen, hätte ich mir jetzt ein Mittagsschläfchen gegönnt. Stattdessen entschied ich mich für einen Wachmacher, einen schottischen Cappuccino, einen mit Kakao getoppten Milchkaffee.
Gleich gegenüber der Oban Destillerie war mir beim Herlaufen der Eckladen „Whisky & Fine Wine“ aufgefallen, in dessen Schaufenster allerlei Flaschen mit nostalgischen und exotischen Etiketten die Touristen und Flaneure anlockten. Kaum hatte ich die Ladentür aufgedrückt, hüpfte mein Herz vor Freude. Ein prächtiges Sortiment aus edlen Whiskys und Weinen aus den besten Anbaugebieten vom Piemont bis Nappa Valley begrüsste mich auf umlaufenden Regalen. Ehrlich! Solch ein Raritätenkabinett war mir bis dahin noch nirgendwo untergekommen. Als ich die eine oder andere Wein- und Whiskyflasche aus dem Regal nahm und näher begutachtete, machte ich allerdings eine frustrierende Entdeckung. Auf winzigen Stickern am Flaschenboden standen verschämt die Preise.
„Sie haben ja ein unheimlich tolles Angebot, mein Kompliment! Aber die Preise, die haben es echt in sich“, sagte ich ohne großes Federlesen zu dem Verkäufer, einem Schotten, der mit seinem steilen Haarschnitt beneidenswert gut aussah. Sein kantiges Gesicht schmückte ein rotbrauner, gepflegter Vollbart und wie ich ihn musterte, wurde mir schnell klar, dieses Gesicht wäre für jede Whisky Werbung ideal.
„Sie sind vermutlich nicht von hier!“, meinte er, mich ernst musternd.
„Ich komme aus Deutschland. Sie werden es nicht glauben, aber bei uns sind die schottischen Whiskys günstiger als hier.“
„Ja, ich weiß, das Ganze ist ärgerlich, zumal sie hier hergestellt werden. Ich kann Ihnen nur erklärend sagen, dass die britische Regierung eine hohe Spirituosensteuer erhebt. Solch eine Besteuerung, die die Leute vom Trinken abhalten soll, ist nicht gerade verkaufsfördernd“, meinte er mit einem gequälten Gesichtsausdruck, der gar nicht zu seinem kernigen Vollbart passen wollte.
Mein Gesicht war wohl länger und länger geworden, als er mir die Preiszusammensetzung erklärte, und wie ich dann auf den Humidor neben der Kasse zeigte, meinte er resigniert: „Zigarren sind leider noch teurer, schon beinahe unbezahlbar!“
Nachdem ich die britische Preispolitik verdaut hatte, beschränkte sich mein Einkauf auf eine apfelgrüne Miniatur, eigentlich nur auf einen besseren Schluck Whisky. Für umgerechnet 9,60 Euro kaufte ich einen Tobermory[1], den mir der Rotbart wärmstens empfohlen hatte. Dankend steckte ich den bescheidenen Einkauf regensicher ein und machte mich auf die Suche nach einem ruhigen Café in einer Seitengasse an der George Street.
Auch wenn es immer noch nieselte, war die Mittagsluft samtig weich und so warm, dass junge Leute rauchend und plaudernd unter der Markise eines Cafés im Freien saßen und, abgehärtet wie Schotten eben sind, den Regen Regen sein ließen. Der fröhliche kleine Luftkurort mit der langen Bank gefiel mir auf Anhieb. Ein freier Bankplatz lud mich ein und ich bestellte einen Cappuccino, der auch gleich kam. Den Kaffee brauche ich nur für das Kakao-Topping zu loben. Dafür verdient das Lebenswasser aus der apfelgrünen Miniatur würdigende Zeilen.
Der Tobermory war zehn Jahre alt und entsprechend blaß stand er im Glas. Gewiss hatte hier kein Master Blender mit E 150 nachgeholfen und die Optik verfälscht. Schon das erste Schnuppern machte die Nase süchtig. Auf Anhieb und unumwunden registrierte sie vertraute Apfelaromen, frische, säuerliche Aromen, unter die sich süßer Most und der Duft von frischgemähtem Gras mischte. Welch eine Frische, welch ein Wiesenduft! Ich sah das frische Grün förmlich zu meinen Füßen sprießen. Und konnte es kaum erwarten, diesen, mir unbekannten Single Malt auf die Zunge zu träufeln.
Am Gaumen überraschte mich eine samtige Weichheit, die nach meinen bisherigen Tastings für einen zehnjährigen Whisky mit 46,3 % vol. mehr als erstaunlich war. Die Wohltat, die der Nase bereits geschmeichelt hatte, fand als fruchtige Süße eine zweite Auflage am Gaumen. Langanhaltend belebte der Geschmack von würzigem Honig, viel Apfel und einer winzigen Spur Minze den Mundraum. Das ganze Erleben kam mir wie eine intensive Gabe Wohlgefallen vor. Erstaunlich, auch der Abgang war genauso toll. Zu den Früchten kam noch Schokolade, Mandel und eine leichte Prise Meersalz hinzu, die dem alkoholischen Brennen die Zügel anlegte.
Der 10jährige Tobermory verdiente ohne Frage das Prädikat: Fauteuil-Whisky. Ohne Wenn und Aber gab ich ihm vier Stützräder und konnte noch unter der Markise im warmen Regen bilanzieren – nach 22 Tastings hatte ich soeben den dritten perfekten Schluck aufgespürt. Mit diesem Jagderfolg war ich mehr als zufrieden.
Tobermory ist eine Brennerei auf der Insel Mull, die bereits 1798 gegründet wurde. Sie ist sehr klein, aber unter Kennern keine Unbekannte. Als handelte es sich um eine Fügung, sollte ich eine Woche später einen berühmten Master Blender kennenlernen, der an der Kreation dieses Tobermory mitgewirkt hatte.
Noch immer saß ich unter der rotweiß gestreiften Markise und lauschte der schottischen Landeshymne, dem nieselnden Regen, während mein Gaumen dem letzten Tropfen Tobermory nachspürte. Noch mehrmals schnupperte ich an seiner Duftfährte, die dem leer getrunkenen Glas entströmte und saß noch eine ganze Weile weltvergessen auf der trockenen Bank des Junge-Leute-Cafés.

Zum Abschluss meines Pausentags in Oban besuchte ich die italienische Pizzeria im Glashaus auf der Mole. Während ich bei einem Tennent’s Blond auf meine Veggie-Pizza wartete, machte keine zehn Meter vor meinem Fensterplatz eine Hochseefähre die Taue los und ging auf Kurs gen Norden. Dunkles, aufgewühltes Hafenwasser schäumte weiß, als sie langsam Fahrt aufnahm und sich kleiner und kleiner werdend in Richtung der Insel Mull davonmachte. Ihr Entschwinden weckte in mir den Wunsch ebenfalls weiterzukommen, weiter nach Norden in die Highlands hinauf.
Mal Flow, mal Speed
Der 15. Mai war ein Tag vom Feinsten. Früh am Morgen erschien ein glühend roter Ball auf der Bühne des Ostens und begleitete mich bis zum Abend, bis er nicht weniger prächtig von der Bühne des Westens verschwand. Seine Strahlkraft belebte die blaue Kulisse so vielversprechend, dass mein Wille bereits in den Morgenstunden nach Bewegung verlangte. Muskulär erholt und bester Laune schwang ich mich in den Sattel, um dem roten Himmelsball entgegen zu fahren.
Magen, Wasserflasche und Proviantdose waren vorsorglich gefüllt, als ich mit Schwung hinter der Gartenmauer meiner Villenpension auf den Radweg Nummer 78 einbog. Auf den ersten Aufwärmkilometern hing in den Kronen der hohen Eichen, die der Radweg kurvig umfuhr, noch immer die Feuchte der Nacht und tropfte ab und an auf mich nieder. Die letzten Flachbauten von Oban blieben zurück und ich bekam freie Sicht auf einen Sandstrand, der weiß und sichelförmig bis tief in den Horizont hineinlief. In vollkommener Stille lenkte mich ab jetzt ein frisch geteerter und weiß markierter Radweg in einem tänzerischen Auf und Ab die Atlantikküste entlang.
Beschwingt ging es lange fort, bis plötzlich hinter einer Kurve ein jähes Hindernis mein Fortkommen stoppte: ein Viehgatter verriegelte den Radkorridor. Unerwartet musste ich bremsen, sogar anhalten, absteigen und das Fahrrad auf seinem Ständer parken. Freie Hand musste ich haben und beweglich sein, erst dann konnte ich den Schnapphebel am sperrigen Viehgatter niederdrücken und das Hindernis zur Seite schieben. Dank einer langen Stahlfeder schwang das hölzerne Gatter auf und die Fahrt konnte weitergehen, diesmal mitten zwischen äsenden Mutterschafen und Lämmern hindurch. Von wegen, die gefräßigen Vierbeiner hätten sich mit der Zeit an die Radler, Skater, Jogger und überhaupt an Zweibeiner gewöhnt. Nein, scheu wie Wildtiere rannten sie beim Näherkommen gleich weg, vor allem die niedlichen Schafpüppchen, die sich immerfort an ihre Mütter drängten. Noch öfters musste ich Weidegatter öffnen – und wieder sorgsam schließen, das forderte jedesmal ein Schild. Der Anweisung folgte ich gerne, denn der Radweg No. 78 war ein so gekonnt von Naturfreunden, Behörden und Farmern angelegter Trail, dass ich ihn schnell lieben lernte und sofort wieder befahren würde. Der glatte und zweispurige Korridor schmiegte sich harmonisch in die wellige Landschaft ein, umging ganze Baumgruppen und lud zum vergnüglichen Kurvenlenken ein. Kein Baum hatte für seinen Verlauf gefällt und kein Bachlauf zugeschüttet werden müssen, dafür überspannten feingezimmerte Holzstege die vielen Wasserläufe. Der Caledonian Cycle Trail No. 78 war ein Geschenk und ich erkannte sofort, dass hier die Natur respektiert und in ihrer Urigkeit belassen worden war. Zudem war der Trail, der auch Wanderer einlud, so umsichtig und durchdacht ausgeschildert, dass die Fahrradbeauftragten aller Länder (eine vermutlich noch zu schaffende Institution) von der Einheitlichkeit der Beschilderung lernen könnten. Die Schilder waren durchgängig königsblau nummeriert und mit der nächsten wichtigen Destination mit Meilenangabe versehen. So war es kinderleicht, das Schild „Fort William 15 m. No. 78“ zu entziffern und ihm zu folgen.
Als ich das tiefblaue Schild passierte, tauchte vor meinem geistigen Auge das Bild eines heimatlichen Radschilderbaums auf: an einer windschiefen Eisenstange hängt ein ganzes Set pickelig angerosteter Schilder, auf denen steht „Windpark Route“, „Innschleife“, „Innradweg“, „Römerradweg“ und so fort. Regelrecht überzüchtet ist die Beschilderung der Radwege in meiner süddeutschen Heimat, wo jeder Kurort, jeder Markt und jede Gemeinde seine örtlichen Radwege nach eigenem Gutdünken markiert und gestaltet hat und wo an Kreuzungen bis zu fünf oder noch mehr fadweiße Schilder, häufig mit untergeschraubten Schildchen, für Verwirrung sorgen. Was für ein erbärmliches Kuddelmuddel – verglichen mit der klaren Schilderkultur hier.

Nach dem Durchqueren der Weiden radelte ich locker über Stunden durch Wälder und aufblühende Wildblumenwiesen und orientierte mich wie ein Nomade am Stand des gewanderten und inzwischen zitronengelben Himmelballs. Selten war zur Orientierung ein Hinweis von nöten, wenn ich ihn mal brauchte, vor allem auf der Passage durch die Dörfer, dann tauchte an sinnvollen Stellen auch gleich eines jener selbstbewussten königsblauen Schilder mit knapper Beschriftung auf. Für diese Hilfestellung sind die Verantwortlichen von Sustrans zu loben, die für Schottland, Nordirland und Wales das National Cycle Network (NCN) aus stillgelegten Eisenbahntrassen, Nebenstraßen und vereinzelt neuangelegten Streckenabschnitten schufen. Diese Infrastruktur wurde nach Fertigstellung nicht einfach sich selbst überlassen, sondern wird andauernd durch Freiwillige überwacht und in Ordnung gehalten. Sustrans wird von der britischen Regierung unterstützt, finanziert sich aber aus Spenden.
[1] tow-bur-mo-ray