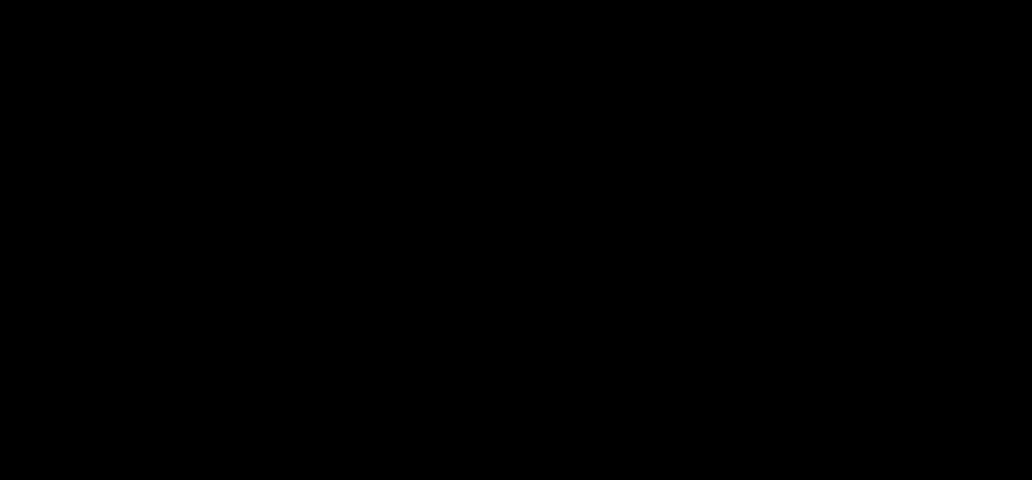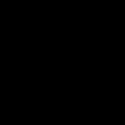Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv im Vorabdruck präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) erscheint am 01.02.2021 im Alba Collection Verlag GbR. Es kann bis zum 15.01.2021 zum Einführungspreis (Subskriptionspreis) von 16,- Euro hier vorbestellt werden.
Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 5)
Nach wenigen hundert Metern zeigte mir der Radweg die Faust, mit einer knackigen Steigung blockierte er mein beschwingtes Fortkommen. Um nicht abzufallen, schaltete ich zwei Gänge zurück, das half, das Tempo zu halten, aber dafür fing ich gehörig an zu schnaufen. Ganz klar, das Tasting war dem Herz-Kreislaufsystem an den Karren gefahren.
Bis sich der Blutalkoholspiegel wieder normalisiert hätte, würde er erst einmal am Fitness-Level fressen, das wusste ich als erfahrener Cyclist von früheren Fahrten mit einem Bierpegel im Blut. Bis zu fünf Prozent fällt die Leistung ab, sagen ärztliche Diagnosen. Testreihen belegen, dass jede Art von Alkohol dafür sorgt, dass die Nebennierenrinde vermehrt das Stresshormon Cortisol ausschüttet, was das Herz heftiger schlagen und im gesamten Organismus die Alarmglocken schrillen lässt. Ist man nun sportlich gefordert, zu Fuß oder auf dem Rad, dann spürt man diese Wirkung noch viel stärker. Mein Hausarzt hatte mir den Rat mitgegeben: essen Sie tüchtig!
Zum Glück hatte ich diesen Rat am Morgen befolgt und mich bei Frau Lorry pappsatt gegessen.
Nachdem ich an der knackigen Steigung eingebrochen war, musste ich mir eingestehen: Whisky ist ein Konditionsräuber! Und die Kombination „sip & cycle“ fügte sich also doch nicht so harmonisch wie ich anfangs vermutet hatte. Nun war die Auffahrt nur einen kurzen Hang hinauf, so konnten sich Herz und Kreislauf rasch wieder beruhigen. Allerdings blieb mir der Durchhänger als Lehre im Gedächtnis haften. Auf der Anhöhe hielt ich an, nicht um wieder zu Atem zu kommen, sondern um mich am Anblick einer zweiten paradiesischen Bucht zu ergötzen. Zwischen buttergelb blühendem Ginsterbüschen stoppte ich das Rad, sog die salzige Atlantikluft ein und schaute und schaute. Sanft rollte sattgrünes Weideland, gesprenkelt mit unzähligen Knubbeln und Knubbelchen weißer Schafe und ihrer Jungen, abwärts zum Saum der Irischen See, wo kalkweiß ein gewaltiger Komplex an der Wasserkante dominierte.
Stand dort unten am Meer ein Kloster, eine spätbarocke Abtei? Womöglich ein geweihtes Stift, nicht weniger prächtig als das Zisterzienser Stift von Stams am Inn. Ach was, nicht so verschnörkelt, nicht so barock, viel sachlicher die Architektur, eher vergleichbar einem Gefängnis, einem Hochsicherheitstrakt, dem allerdings die Stacheldrahtumzäunung fehlte. Mit beiden Beinen am Boden verweilte ich noch eine Weile, um dieses Bild auf dem Stick der Erinnerungen zu speichern, dann schwang ich mich wieder in den Sattel und rauschte den Hang in einem ausschweifenden Bogen hinab, immer wieder in die Ferne spähend, immer wieder von neuem gefesselt von dem größer und größer werdenden Bauwerk im Herzen der Bucht.
Die flotte Fahrt beendete ich auf einem asphaltierten Platz, in dessen Mitte eine ausrangierte Brennblase stand. Die kupferne still stand mitten auf dem Platz als das Wahrzeichen der Brennerei Ardbeg[1]. Ihr rotes Metall glänzte poliert und wirkte ausgesprochen edel. Aber Ardbeg’s werbewirksame Ikone hatte einen Schönheitsfehler. Sie war ein Fragment, es fehlte ihr obendrauf das Geistrohr, das in Schottland lyne arm oder Schwanenhals heißt. Doch selbst als Fragment zog die Brennblase die Blicke der Handyknipser auf sich. So wie sie zwiebelförmig und ausrangiert in der Sonne glühte, wirkte die kupferne Blase auf mich wie eine festgefügte Erklärung: Hier wird keine Heilige Messe zelebriert, hier werden auch keine Verbrecher gefangen gehalten, hier wird Whisky gebrannt.

Vor der Tür zum gut ausgeschilderten Besuchszentrum standen Holztische und Holzbänke unter Sonnenschirmen. Die Islay Sonne knallte schon derart, dass ich mich fragte, bist du noch in Schottland oder schon in Portugal? Nicht auf dem entfernt gelegenen Parkplatz stellte ich mein Rad ab, sondern direkt neben der Eingangstür lehnte ich es privilegiert an die aufgeheizte Wand. Noch bevor ich es wieder alleine ließ, kam die alte Frage auf: abschließen oder nicht? Wie gesagt, Schottland ist ehrlich, aber so viele, so viele Touristen gingen hier aus und ein, schon jetzt zur Mittagszeit herrschte ein stetiges Kommen und Gehen. Die Destillerie Ardbeg, 1815 gegründet, ist weit mehr als ein Muss auf Islay, Ardbeg ist das Mekka profaner Pilgerströme.
Wenn das Center von Laphroaig in folkloristischem Design konzipiert war, dann war das von Ardbeg extrem streng und zurückgenommen gestaltet. Im schummrigen Café mit Vierertischen saß der Gast unter einer zehn Meter hohen, offenen Holzkonstruktion, die das gewaltige Dach trug, und blickte in der düsteren Atmosphäre von Schwarzweiß auf wandhohe Poster vom wild schäumenden Meer. Der hohe Raum des Verweilens, des Shoppens und des Tastings wurde durch das spärlich einsickernde Licht und die schwarzweiße, minimalistische Dekoration zu einem Altarraum, in dem ein riesiges Poster des keltischen Kildalton-Steinkreuzes aus dem 14. Jahrhundert den Gedanken an die Götterdämmerung aufkommen ließ.
Wären da nicht die mattgebeizten Regale voll schwarz verpackter Ardbeg-Whiskys und Merchandising Artikel wie Jacken, T-Shirts, Kosmetika, Kappen und Notizbücher als profane Boten der Neuzeit gewesen, man hätte andächtig niedersinken und beten können. Aber nur kurz, denn ein Blick auf die Preisschilder und schon war es um die Andächtigkeit geschehen: das billigste Produkt im Logo-Sortiment, ein Plastik-Kugelschreiber chinesischer Provenienz, kostete acht Pfund.
Durch die Flügeltüre am Eingang drängten so viele neue Besucher nach, dass sich die scheidenden nur mit Mühe ins Freie zu schieben vermochten. In diesem Jahrmarktgetümmel hätte eine Diebeshand sehr leicht in die Regale greifen und jede Menge Ardbegs mitlaufen lassen können, denn an Personal mangelte es an den Ständen und im Café. Lange Minuten war nicht einmal die Kasse besetzt.
Kaum, dass ich an einem Vierertisch Platz genommen hatte und zur Ruhe kam, bedrängte mich die Düsternis der monumentalen Dekoration und unwillkürlich musste ich an die düstere Subkultur von Gothic Queen denken, die mir auf meiner Reise noch öfters begegnen sollte. Für mich als Kind der Nachkriegszeit war diese Lust an düsterer Vision befremdend. Aber ich verbat mir das Werten und schon ergriff mich die Kulisse in ihrer Todessehnsucht und ermutigte mich, dieser Chiffre nachzuspüren.
Die Ardbeg Flaschen mit ihren Runen, auch das mythisch anmutende Ambiente des Cafés, erweckten die keltische Kultur zum Leben und als ich kurz die Augen schloss und in den hohen Saal hineinhorchte, vernahm ich ein Gemurmel, eine Litanei von Sprechgesängen, selten ein Lachen, Geräusche wie im Refektorium einer mittelalterlichen Abtei. Urplötzlich saß ich inmitten von Mönchen, die den keltischen Ritus zelebrierten und sich betend um den hohen Schaft des Hochkreuzes von Kildalton scharten. In ihrem esoterischen Zirkel lebten Alchimisten, die im Verborgenen mit Drogen und Heilkräutern experimentierten, vielleicht sogar im Selbstversuch ihr Leben opferten, um aqua vitae in höchster Reinheit zu destillieren. Gefesselt von der keltischen Atmosphäre bei Ardbeg, verfestigte sich die längst gefasste Idee, die Urdestille des schottischen Lebenswassers in der Benediktinerabtei von Lindores am Ende meiner Reise aufzusuchen.
Wieder öffnete ich die Augen und vor mir stand ein Glas, auf dessen Grund sich ein goldener Schluck wiegte. Es augenblicklich zu ergreifen, ging auf keinen Fall, zu vorbelastet war ich noch immer, zu lebhaft spukte auch jetzt noch der Geist des Jugendrauschs im Hirn herum. Um ehrlich zu sein, bereits bei der Bestellung hatte sich ein Anflug von Übelkeit meines Magens bemächtigt. Aber es half nichts! In den sauren Apfel musste ich jetzt beißen, ich musste den Rauch, die Asche und auch den geräucherten Speck riechen und schmecken, um mir ein faires Urteil über den berühmtesten aller getorften Whiskys erlauben zu können.

Kurzentschlossen ergriff ich das handliche Nosing Glas am Bauch und spannte es zwischen Daumen und die restlichen Finger ein. Der Auftritt des zehnjährigen Ardbeg war dezent und erstaunlich hell, viel heller als das braune, torfhaltige Flusswasser der Insel. Wie flüssiger Bernstein stand der Ardbeg im Glas und beim Schwenken zeigte er Schlieren und Rillen wie es sich für einen guten Malt mit mehr als 46 % vol. gehört. Seine Farbe beruhigte in ihrer dezent leuchtenden Schattierung und schon traute ich mich.
Der erste Schnuppervorstoß – ein Schock: geräucherter Speck, üble Gerüche wie aus einem überquellenden Aschenbecher, Terpentin, auch Seife und muffiges Leder griffen meine olfaktorische Behaglichkeit an und weckten sofort unschöne Erinnerungen. Schon wollte ich resignieren und das Glas von mir schieben und lieber zum gezuckerten, kakaogepuderten Capuccino greifen. Mit Willenskraft überwand ich den ersten Ekel, ja Ekel, und träufelte mir ein Schlückchen in den Mund: nicht auf die vorderen Knospen, sondern gleich auf den Zungengrund. Augenblicklich setzte der Speichelfluss ein, gleich darauf ein Brennen. Aber das war nur die erste, noch flüchtige Berührung. Im nächsten Moment erlebte ich einen Umschwung. Der Gaumen öffnete sich willig und verlangte nach mehr, denn jetzt schmeckte er Aromen von Früchten wie Mango und Ananas, Rosinen und Trockenfrüchten, die den Torfgeschmack massiv bedrängten. Und wie durch einen Zaubertrick verwandelte sich die Kernseife in Marzipan. Der Abgang war ohne Frage holzig, allerdings ausbalanciert mit einer Malznote und dem fleischigen Geschmack von schwarzen Oliven. Und über allem erlebte ich eine Novität, die ich vorher nicht gekannt hatte: im Abgang oszillierte der Ardbeg zwischen bitter und süß, was leicht verwirrte. Aber schon wegen des Abgangs gab ich dem Torfhammer eine zweite Chance.
Mit einem großen Schluck Wasser spülte ich nach und träufelte aus einer bereitstehenden Pipette einige Spritzer ins Glas. Punktuell trübte sich die Oberfläche ein. Das war alles andere als schlimm, nur eine harmlose chemische Reaktion, hervorgerufen durch die natürlichen Ketten von Fettsäuren. Die kleine, sichtbare Sensation war sogar gut. Der milchige Schleierfaden indizierte, dass der Ardbeg nicht durch Kühlfilterung kastriert worden war und dass in ihm noch alle Ballaststoffe lebten.
Der zweite Schluck überraschte durch seine frugale Dominanz, was die Torfnote stark milderte, obwohl diese noch immer die Textur bestimmte. Im Resultat traf der zehnjährige Ardbeg allerdings nur beschränkt meinen Geschmack, deshalb erhielt er auf der Skala zwei Stützräder. Okay, diese Bewertung mochte mittelmässig ausgefallen sein, aber trotzdem war sie von Bedeutung, denn dank ihr war ich fürs erste an einem persönlichen Ziel angekommen: ein Torfwhisky, ein peated malt, konnte mich ab jetzt nicht mehr schrecken.
Im Besuchszentrum und auf dem Vorplatz ging es inzwischen noch lebhafter zu, unter den Sonnenschirmen ballten sich Gruppen von Busreisenden und alle lechzten wie eine Wüstenkarawane nach Schatten. Ihr Warten auf den Reiseleiter verkürzten diese Whiskytouris mit Selfies aufnehmen und Selfies posten. Kurz hielt ich inne und überlegte: am quirligen Auftrieb war gut zu studieren, wie ein raffiniert ausgeklügeltes Marketing einer Marke zu Weltruhm verhelfen kann. Dazu muss man wissen, dass das Werben mit gruftiger Gothic Kultur von den Franzosen kommt, denn die Brennerei, die rund 2,4 Millionen Liter im Jahr produziert, befindet sich im Besitz von Moèt Hennessy.
Routiniert fand ich die Zahlenkombination am Fahrradschloss und schwang mich fluchtartig in den Sattel. Inmitten der mit Bus oder Auto angereisten Besucherlawine kam ich mir in den Radklamotten und mit Helm wie ein Pausenclown vor, der das Pauschalprogramm ergänzen sollte. Was ist das für ein Spinner, der zum Whisky Tasting nach Ardbeg radelt? fragte sich gewiss der eine oder andere Besucher wie er mich wegfahren sah.
Zugegeben, der hastige Aufbruch kam einer Flucht gleich und keine hundert Meter hinter dem Parkplatz präsentierten die Gedärme die Rechnung. Ein gewaltiger Rülpser stieß mir auf und ein Torfschwall schwappte mir wie dem Feuerschlucker die ausgehauchte Flamme über die Lippen. Dieses gastroenterologische Signal bestätigte einmal mehr, dass ein Ardbeg und ich keine besten Freunde werden würden.
[1] ard-beg