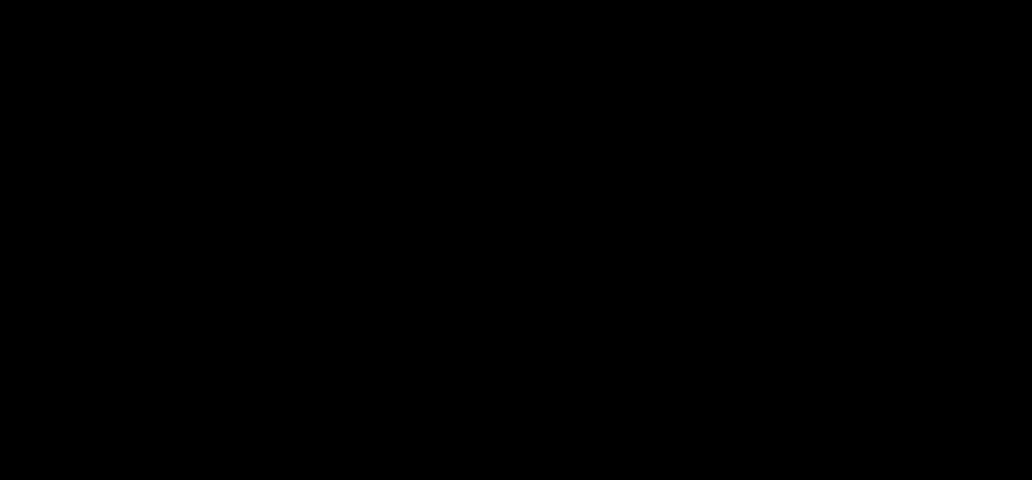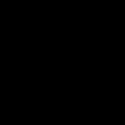Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv im Vorabdruck präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Franz‘ heimliche Liebe gilt Schottland und dem Wasser des Lebens. In Whisky Cycle entführt er den Leser auf ca. 280 Seiten nach Schottland, wo er in fünf Wochen 1.500 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegte. Seine Besuche in 17 großen und kleinen Destillerien waren verbunden mit Tastings und der Suche nach dem perfekten Schluck – the perfect dram.
Das Buch ist auch ein Stück Autobiografie. So steht am Anfang eine Jugendsünde, ein Vollrausch im Alter von siebzehn, den ihm der fahrlässige Umgang mit dem legendären VAT 69 einbrachte. Dieser Rausch hatte zur Folge, dass er zwanzig Jahre lang Whisky weder riechen noch schmecken konnte. Erst dann wich die Abscheu einer immer stärker werdenden Neugier. Auf der Radreise durch Schottland fand dann die endgültige Aussöhnung statt. Aus diesem Grund endet das Buch mit einer Verkostung des Jugendwhiskys VAT 69 an einem Ort, wo die schottische Whiskygeschichte ihren Anfang nahm.
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) erscheint am 01.02.2021 im Alba Collection Verlag GbR. Es kann bis zum 15.01.2021 zum Einführungspreis (Subskriptionspreis) von 16,- Euro hier vorbestellt werden.
Kommen Sie also mit auf eine Reise durch die Zeit – und zu 17 Brennereien in Schottland:
Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 2)
Ein Rausch war in den sechziger Jahren ein Ausrutscher, man dachte sich nichts, man kotzte und gleich war das Elend wie weggedrückt. Auf keinen Fall wurde das Missgeschick psychologisierend hinterfragt. Und was die Getränke anging, gab es noch nicht diese hochgestochenen Dispute über Mundgefühl, Textur und Körper. Meine Freunde und ich tranken frei von der Leber weg und in unseren Trinkrunden wurde viel gelacht und ab und an gaben wir uns eben die Kante.
Leider wird mir die Quittung jener Sturm- und Trinkjahre noch heute präsentiert. Über zwanzig Jahre wurde Whisky zu einem Getränk, das mich anwiderte wie Senf, Sülze und gebratene Leber. Allein schon sein Geruch nach geräuchertem Speck, kalter Asche und nasser Wolle war mir ein Gräuel, der jeden Annäherungsversuch mit einer Abkehr enden ließ. Erst Jahre nach dem Whiskytod wurde mir klar: mein Rausch mit siebzehn war eben nicht nur eine jener Sauf-Kotz-Initiationen, mit der werdende Männer gerne prahlen, sondern ein selbstzerstörerischer Akt, etwa so, als öffnete sich ein Selbstmörder die Pulsader.
Mit Erreichen der Lebensmitte verspürte ich dann doch das Verlangen, dass wir, der Whisky und ich, uns aussöhnen sollten. Wider Erwarten kam es auf einer Japanreise dazu. Ich bestieg den Berg Yarigadake in den Japanischen Alpen und war im Hotaka-dake Gebirge alleine auf 2500 Höhenmetern unterwegs, als mich ein Wettersturz überraschte und ich den Weg aus den Augen verlor. In einer menschenleeren Gegend voller Geröllhalden und abschüssiger Rinnen irrte ich umher, immer steiler wurde das felsige Gelände und plötzlich setzte auch noch Schneetreiben ein. Jetzt wurde es richtig gefährlich: der Fels verwandelte sich in eine glitschige Rutschbahn. Dichter Schneefall verschluckte schnell jede Spur und hinter einer Felsnase tauchte ich in eine blindmachende Leere ein. Mit mulmigem Gefühl inmitten von Weiß tappte ich langsam weiter in der eingeschlagenen Richtung, aber das brachte mich nicht wirklich weiter. Zum Glück hörte der Schneefall irgendwann auf und aus der Ferne entdeckte ich stecknadelgroß ein funzeliges Licht. Auf den heller werdenden Lichtpunkt lief ich nun zu, und aus dem Dämmerlicht schälte sich der Schemen eines beleuchteten Zelts.
Erschöpft, aber auch erleichtert, fand ich einen campierenden Japaner, der ganz alleine im aufgeschlagenen Zelteingang saß und mich anstarrte, als sei ich ein Hungergeist oder ein Wesen aus dem Jenseits. Doch rasch hatte er mein Auftauchen aus dem Nichts verdaut und lächelte mir einladend zu. Mit seiner behandschuhten Rechten lud er mich ein, neben ihm im Zelteingang Platz zu nehmen. Ohne einen Hauch von Misstrauen und wie selbstverständlich bot er mir eine Schale Misosuppe an. Aber zuvor hielt er mir einen Emaillebecher hin und forderte mich wortlos auf zu trinken.
Ich griff nach dem Becher, roch und – zuckte zusammen. Eine Welle von Gerüchen flutete die Nase. Kurz, nur für den Bruchteil von Sekunden, schwappte mit den Aromen die Erinnerung an den Komarausch in mein Gehirn und lähmte das Verlangen nach dem wärmenden Drink. Ja, der dargebotene Becher provozierte einen Konflikt: sollte ich den Vorsatz „Nie wieder Whisky“ über Bord werfen, sollte ich alle Ressentiments vergessen und einfach zugreifen und mich durch die wärmende Gabe aus der Umklammerung der Kälte lösen? Oder sollte ich die gastfreundliche Offerte ausschlagen, den Whisky unter Ausflüchten dankend ablehnen und mich mit der Misosuppe begnügen? Massiv wurde mein Kopf von der Erinnerung bedrängt, aber gleichzeitig forderte der sehnsüchtige Wunsch nach Wärme ihren Tribut und ich erlaubte mir den ersten Whiskyschluck nach zwanzig Jahren Abstinenz.
Augenblicklich explodierte in mir eine Wärmebombe, augenblicklich schlug die Kälte, die sich in den Knochen festgebissen hatte, in wohlige Wärme um und flutete den Körper von der Zehenspitze bis unter die Haarwurzel. Wirklich, so teuflisch der Vollrausch in der Jugend, so göttlich der Becher Whisky in jenen eiskalten Stunden in den Japanischen Alpen.
Schlimmer, viel schlimmer als es mir in den Japanischen Alpen erging, musste es dem irischen Polarforscher Ernest Henry Shackleton im Jahr 1914 auf seiner Antarktis Expedition ergangen sein, als er meinen Schicksalswhisky, jenen VAT 69, aus „medicinal and celebratory purposes“ an seine Mannschaft austeilen ließ. Im Gegensatz zu jenen hartgesottenen Männern, die 365 Tage als Gefangene im ewigen Eis die Schrecken von Kälte und Tod erlebten, gelang mir noch vor Einbruch der Nacht der Abstieg ins Tal von Matsumoto.
Längst wieder daheim, saß ich eines Abends in München am Tresen der Atlantic Bar, alleine mit meinen Gedanken. Was sollte ich trinken? fragte ich mich und suchend wanderte mein Blick die Familie der Flaschen entlang. Vor meinen Augen leuchtete und blinkte es in allen Regenbogenfarben und ich glaubte, durch ein Kaleidoskop von wetteifernden Formen und Farben zu sehen. Das ganze Sortiment kam mir wie eine Patchwork-Familie vor. Je länger ich auf die halbvollen und vollen, die bauchigen und die schlanken Flaschen blickte, desto unschlüssiger wurde ich in getränketechnischer Hinsicht: Ein fruchtiger Cocktail? Ein zupackender Kurzer? Ein samtiger Cognac? Ein trockener Martini, ein klärender Gin? Unschlüssig suchte der Blick nach einem bekannten Etikett, nach einer Trinkempfehlung.
Mich trifft der Schlag, das glaub ich jetzt nicht! Gleich muss ich nochmals hingucken. Im Barsortiment steht auf dem Glasboden des obersten Regals eine schwärzlich grüne Flasche mit der weißen Zahl 69 auf dem Etikett. „Hallo, alter Schlawiner, wir kennen uns doch. Mein Gott, ist das lange her, dass wir uns begegnet sind“, höre ich mich sagen. Und in Gedanken rechne ich nach, gewiss sind an die dreißig Jahre verstrichen, seit wir uns in Jugendtagen auf so dramatische Weise trafen.
Dem Barmann ist mein Erstaunen nicht entgangen. Als ich mich über den Tresen beuge, den Kopf neugierig vorrecke und auf die oben einsortierte Flasche starre, wird er aufmerksam. „Aha, Sie sind fündig geworden, der VAT 69 soll es sein!?“
Kurz abwehrend, wedele ich mit der Hand und schüttele verneinend den Kopf. Doch dann überlege ich es mir anders und ermuntere ihn, mir ein Glas pur und ohne Eis einzuschenken.
Vom Glasboden des Tumblers erhebt sich beim Schnuppern eine fettige Wolke von Rauch! Oh weh, schon holt mich die Erinnerung an den vergessen geglaubten Komarausch ein. Der Geruch von geräuchertem Speck ist wieder da wie damals vor dreißig Jahren. Zum Glück tummeln sich in der rauchgeschwängerten Wolke Wölkchen von Menthol und ihre Frische belebt die Nase mit einem prickelnden Hauch von Alkohol. Schnuppern geht ja noch, aber der erste Schluck, er erfordert Überwindung. Nur zaghaft, ausgesprochen zögerlich, eben von der Jugendsünde vorbelastet, benetze ich die Zungenspitze. Hier, wo die Geschmacksdetektive der Süße auf die Schliche kommen, offenbart der holzbraune Scotch eine exotische Fruchtnote, auch Vanille und Spuren von dunkler Schokolade und ein wenig Leder schmeicheln dem Gaumen. Erstaunlich, wie rasch der Speichelfluss einsetzt und Grapefruit und Feige zu schmecken sind. Kurz entflammt ein Brennen den Mund und die Zunge, aber nur kurz, schon löst sich das Kratzen in einem Wärmebad auf.
Der zweite Schluck offenbart von Neuem jene Rauchspecknote, die die Fans von getorftem Whisky so lieben. Noch bevor ich das Glas wegen des wenig feinen Geruchs von den Lippen nehmen kann, grüßen Fruchtnoten süß und exotisch, was kurz für Verwirrung sorgt, denn beim Kauen prickelt der dichte Alkohol angenehm und überschwemmt die Zunge mit Birnenaromen, die auf Malz dahergeschwommen kommen. Mmmh, gar nicht so übel, dieser VAT 69, man muss ihm nur Geduld entgegenbringen.
Als ich in der Atlantic-Bar meinen Schicksalswhisky nach so vielen Jahren erneut verkostete, diesmal homöopathisch dosiert und ohne den jugendlichen Überschwang, erkannte ich: Es ist nicht das Getränk an sich, das über Top oder Flop entscheidet, sondern der Umgang mit der Spirituose, die man entweder bewusst oder unbewusst goutieren kann. Das Rendezvous mit dem VAT 69 nach so vielen Jahren der Verweigerung hatte ein schlummerndes Thema berührt und erreicht, dass ich dem Lebenswasser der Schotten ab jetzt wieder mit Neugierde und weniger voreingenommen begegnen konnte.
Eines frühen Morgens rissen mich Kirchenglocken aus dem Schlaf und als ich hochschreckte, fiel ich aus einem Traum, der mein Leben bereichern sollte: ich saß auf einem Fahrrad, die linke Hand am Lenker, während die rechte ein Whiskyglas umschloss, dabei trat ich munter in die Pedale. Verrückt, solch ein Traumerlebnis! Noch nie hatte ich beim Radeln oder sonst einem Sport ein hochprozentiges Getränk aus einem Glas oder Flachmann zu mir genommen. Nun weiß die Wissenschaft seit C.G. Jung, dass der schlafende Mensch im Traum Unglaubliches erleben kann – in ein Tier kann er sich verwandeln, auch wie ein Vogel fliegen. Er träumt, dass sein Körper rennen und rennen und doch nicht von der Stelle kommen kann. Die krassesten Gegensätze können sich auflösen und harmonisch verschmelzen, aber nur im Traum und nicht in der Dualität des wirklichen Lebens.
Nach der ersten Verwirrung deutete ich das Traumerlebnis als Aufforderung, eine Radfahrt durch das Land des Whiskys zu unternehmen. Wie wäre es, von Brennerei zu Brennerei zu radeln, anzuhalten und immer wieder ein Gläschen Scotch zu probieren? fragte ich mich noch im Liegen. Da ich für mein Leben gerne Rad fahre, auch weite Strecken, fand ich schnell Gefallen an dem Gedanken und beim Frühstück wurde die Idee von „sip & cycle“ geboren. Zugegeben, das Motto klingt wie ein Widerspruch, aber auch in Schottland darf man mit 0,5 Promille einen fahrbaren Untersatz steuern. Beim alkoholisierten Radfahren zeigt sich die Polizei sogar noch großzügiger: solange man sich auf dem Fahrrad halten kann und niemanden gefährdet, darf man beliebig viel intus haben.
Schotten haben einen guten Humor, auch neigen sie zum Philosophieren, so sollten sie mir eines Tages den Rat geben: Willst du eine Flasche Whisky auf dem Fahrrad transportieren, dann hast du zwei Optionen. Du kannst sie auf dem Gepäckträger mitnehmen. Das ist aber riskant, denn wenn du stürzt, wird die Flasche zerbrechen und der kostbare Inhalt geht flöten. Aufgrund dieser Gefahr sei die zweite Option doch viel besser: die Flasche noch vor dem Aufsteigen auszutrinken. Augenzwinkernd fügen sie hinzu, dass man die zweite Option doch nicht allzu ernst nehmen sollte, denn in diesem Fall werde man vermutlich mehrmals unfreiwillig absteigen, aber wenigstens geht dann der Whisky nicht flöten. Vor diesem Hintergrund kann ich nur den besten aller guten Ratschläge geben: übe dich stets und ein Leben lang in der Kunst des Balancierens.
* * *
Wir haben Mai, und ich fliege nach Edinburgh mit mehr als nur mit Handgepäck. Als Sperrgut steht mein Steppenwolf, bis zur Unkenntlichkeit in Bläschenfolie eingewickelt, mit einwärts gedrehten Pedalen, mehr oder weniger platten Reifen und einem, in Fahrtrichtung geschwenkten Lenker im Frachtraum der Maschine. Zum Glück handelt es sich bei dem sperrigen Teil um kein E-Bike mit explosiver Batterie, sondern um ein rein mechanisches Tourenrad, sonst dürfte es nämlich nicht mitfliegen. Aufgegeben habe ich auch zwei Packtaschen, die zwergenhaft klein zwischen Schalenkoffern nach Schottland fliegen. Randvoll sind die beiden Gepäckträgertaschen mit dem Allernützlichsten gefüllt: mit Regenbekleidung, die lediglich aus einem eng anliegenden Anorak mit verschweißten Nähten und einer kurzen, wasserdichten Überhose besteht. Bloß kein Regenponcho! Der flattert und schlägt und bringt einen darunter zum Schwitzen. Verzichtet habe ich gerne auf wadenhohe, geringelte Tennissocken und braune Riemchensandalen. Auch fehlen Kondome und Viagra in der Notfallapotheke, dafür besorgte ich Pflaster und eine elastische Binde und natürlich scharfriechendes Olbas gegen Erkältung und Übelkeit. Vom Gepäck her habe ich mich radikal eingeschränkt und ganz auf elegante Accessoires und Schnuckeliges verzichtet, dafür den Spruch beherzigt „Wenn Sie es unterwegs wie zuhause haben wollen, dann verschwenden Sie ihr Geld nicht fürs Reisen – bleiben Sie lieber daheim“.
Radfahrend mit Minimalgepäck habe ich schon weit über tausend Kilometer auf einer von vielen Touren zurückgelegt, aber auf dem Whiskyweg bin ich noch nicht sehr weit vorangeschritten und was Tastings angeht, habe ich es noch lange nicht zur Meisterschaft gebracht. Sowohl meine Nase als auch mein Gaumen müssen erst noch lernen, als Detektive die verschiedensten Düfte und Aromen aufzuspüren. Auf der bevorstehenden Schottlandtour will ich mich nicht nur mit dem Whisky aussöhnen, nein, ich verfolge das hochgesteckte Ziel, den perfekten Schluck zu entdecken. Mit perfekt meine ich: vollkommen, einwandfrei, meisterhaft, ideal. Aber trifft das den Punkt? Ist das Perfekte, sozusagen die Krone der Schöpfung, erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann? Oder ist es umgekehrt, ist sie erreicht, wenn man nichts mehr weglassen kann, wie Antoine de Saint-Exupéry behauptet?