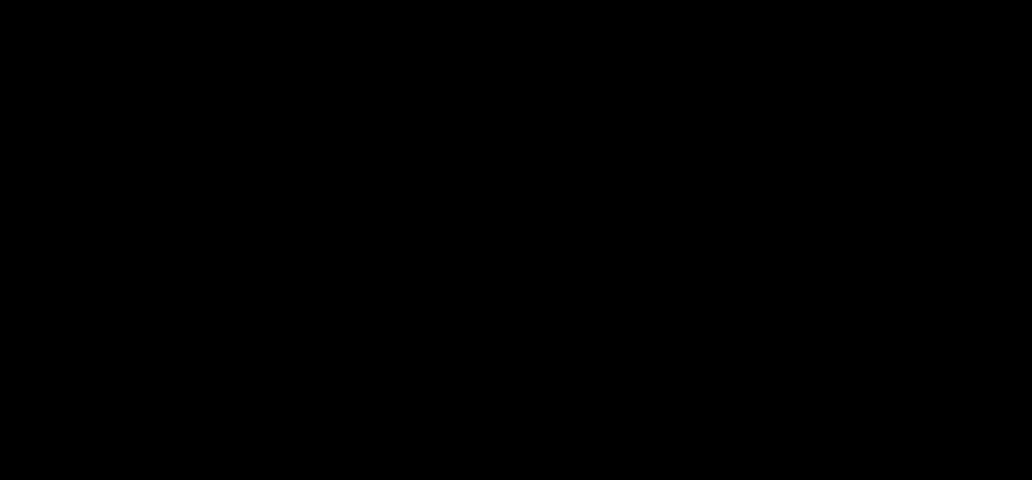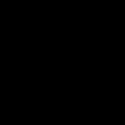Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 26)
Zusammen mit einem Pulk probiersüchtiger Touristen betrat ich den Shop gleich hinter dem Eingang. Obwohl auch hier Logo-Klamotten von M bis XXL die Regale und Ständer füllten, nahm ich sie nur flüchtig wahr: wieder waren sie schwarz und made in China – anders als in den besuchten Brennereien, eben nur das Logo. Dafür war der hohe Verkaufsraum ein sehenswertes Unikat. Die ursprünglichen Backsteinwände waren vom alten Putz befreit und der Stein war neu verfugt, aber alt und im ursprünglichen Ziegelrot belassen. Über eine Eichendielentreppe stieg ich in den ersten Stock hinauf, wo sich früher ein großer Mälzboden befunden hatte. Entlang der roten Wände hingen historische Schwarzweißaufnahmen, und in einer Ecke stand die Schankbar, hinter deren Tresen ein Senior als Bartender die Besucher zum Probieren animierte. Bei ihm bestellte ich ein Dram Destiller’s Edition, 43 % vol. Der pensionierte Arbeiter, der sich für acht Pfund die Stunde einen Zugewinn verdiente, wie er mir später verriet, servierte das Dram und gab noch eine Erklärung als Nachschlag: „14 Jahre reifte diese Edition und zwar ausschließlich in Ex-Bourbonfässern. Das Besondere an dieser Abfüllung ist die fünftägige Gärung der Maische und eine sehr langsame Destillation des Feinbrands. Diese beiden Merkmale sind seit altersher die Besonderheit unseres Hauses. Übrigens ist diese Edition unser beliebtester Single Malt, wir exportieren ihn vor allem nach Frankreich und in die USA.“

Mein Blick ging vom Verkostungsglas, an dessen Grund ein goldener Oban schimmerte, zu seinen blauen Augen, deren Strahlkraft die des Malts übertraf. Seine vertrauensvolle Art gefiel mir so sehr, dass ich mir viel Mühe mit dem Verkosten geben wollte. Anerkennend nickte ich ihm zu und noch bevor ich das gereichte Glas zur Nase führte, hielt ich es schräg gegen den Deckenstrahler. Golden schaukelte der 14jährige vor meinen Augen und wies ordentlich Schlieren auf, ölige Bänder, die träge abwärtsflossen, als ich das Glas kreiselnd in Bewegung setzte. Gegen das künstliche Licht mutete sein Gold so dunkel an, dass ich mich fragte, war dieses blinkende Goldbraun wirklich echt, war es wirklich das Ergebnis eines 14jährigen Daseins in der Eiche? Oder hatte man farblich nachgeholfen? Da ich mir nicht sicher war, fragte ich den liebenswürdigen älteren Herrn hinter der Theke und nach kurzem Zögern gab er die Wahrheit preis: „Wir verwenden für diesen Oban als Zusatz caramel, dadurch wird seine Farbe goldener und auch dunkler. Das kommt beim Kunden, vor allem bei den Amerikanern, besser an als eine wässrige Blässe.“
Aha, also war meine Vermutung doch richtig, dass man den Teint des Malts künstlich eingefärbt hatte. Ich sagte nichts, registrierte diesen Eingriff aber als Minuspunkt. Ohne mich mit der Optik weiter aufzuhalten, ließ ich die Nase ihres Amtes walten: das linke Nasenloch erlebte eine ganze Kette süßer Karamell Aromen, die so stark daher kamen, dass sie eine erdige und trockene Torfnote in Schach halten konnten. Anschließend roch ich mit rechts und erschnupperte eine stark ausgeprägte Rauchnote, auch geräucherten Speck und eine Prise Seetang. Der erste Schluck lud süße Exotik auf die Zungenplatte und die Backentaschen füllten sich erneut mit einer Vanille Note. Leider erlebte der Mundraum beim Kauen diese nur flüchtig, zu schnell füllte er sich zum Speichel mit der Bitterkeit von Torf und kaltem Rauch. Schwach, zu schwach für meinen Geschmack, kitzelten würzige Südfrüchte – Feige, Zitrus und Rosine – den weichen Gaumengrund, bevor sie im Abgang verschwanden. Gerade im Abgang, der sich kurz und gradlinig darbot, überwog das Hölzerne der Eichennote und ließ jegliche Spur von Fruchtigkeit vermissen. All diese Eigenschaften addiert, hielt sich meine Begeisterung in Grenzen. Nach dem Urteil von Augen, Nase und Mund bewertete ich den populärsten Oban guten Gewissens mit zwei Stützrädern. Fein säuberlich notierte ich dieses Resultat, vergaß aber nicht, hinter das Wörtchen „caramel“ ein Ausrufezeichen zu setzen. Unbedingt musste ich mehr über diesen Zusatz erfahren.
Caramel klingt nach Schleckerei, nach Bonbonsüße, für den Kenner auch nach vielen leeren Kalorien. Ja, man könnte den harmlosen Begriff auch so verstehen, dem Whisky sei lediglich eine Prise von erhitztem Kristallzucker zugesetzt worden. Doch so harmlos ist die Sache bei weitem nicht.
Nach dem deutschen Lebensmittelgesetz muss der Zusatz, den die Engländer, Schotten und Iren verharmlosend „caramel“ nennen, deklariert werden und kleingedruckt muss auf dem Flaschenetikett stehen: „Enthält Farbstoff: Zuckerkulör“. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich um eine Lebensmittelfarbe, die streng genommen dem schottischen Reinheitsgebot widerspricht, wonach nur Gerste, Wasser und Hefe als Ingredienzien zugelassen sind. Damit nicht genug: in Schottland, England, Irland und vielen anderen Ländern braucht kein Hinweis auf das unnatürliche Additiv auf dem Etikett zu stehen. Ganz von alleine drängt sich also die Frage auf: was hat es mit Zuckerkulör auf sich und wofür ist der Zusatz, der die chemische Bezeichnung E 150 trägt, gut?
Um es vorweg zu nehmen: nicht der Geschmacksverbesserung dient die Lebensmittelfarbe E 150, sondern der kosmetischen Behandlung des Teints. Ja, das Aussehen eines Whiskys ist in diesem Fall mindestens so wichtig wie sein Geschmack. Der Farbzusatz E 150 entsteht durch das Erhitzen von Glucose Sirup unter Verwendung von Schwefelsäure und Ammoniak, also von chemischen Verbindungen, welche hochdosiert die Schleimhäute reizen. E 150 ist eine pechschwarze, extrem bittere und verbrannt riechende, synthetische Substanz aus dem Labor und nicht aus der Natur. Nun wird in der Nahrungsmittelindustrie seit vielen Jahren synthetisches E 150 für die Färbung von Lebensmitteln wie Wurst, Instant Suppen, Waffelröllchen, Malzbier, Coca-Cola und Süßigkeiten ganz legal untergemischt, vorausgesetzt die Tagesdosis von 300 mg/kg Körpergewicht wird eingehalten. Bei diesem recht allgemeinen und schwer kontrollierbaren Gesundheitshinweis ist Vorsicht geboten! In Tierversuchen kam es nach der Injektion von E 150 d, auch Ammoniumsulfit-Zuckerkulör genannt, in hoher Dosis zu starken Muskelkrämpfen im Körper der gequälten Ratten.

Von vielen, allerdings nicht allen, Brennereien wird Zuckerkulör verwendet, um dem Malt einen dunkleren Teint, eigentlich das Indiz für eine lange Fassreifung, zu verleihen und einer Fasslage eine Einheitlichkeit zu geben. Aber mit Zuckerkulör allein ist es beim Whiskyfärben noch nicht getan. Zum Färben von Spirituosen aller Art sind stabile und lösliche Mischeigenschaften notwendig und dafür braucht man neben Zuckerkulör noch Sulfit als Trägerstoff.
Traurig, aber wahr: Das Vorgaukeln einer langen Fassreifung ist durchaus vergleichbar mit der Farbtäuschung bei Seelachs, der in Wirklichkeit gar kein Lachs ist. Was da rosa in der verschweißten Verpackung lockt, ist weißes Fleich vom Dorsch, das mit dem Zusatz von Azofarbstoffen, Gelborange S und Cochenillerot A rötlich eingefärbt wurde. Das mag ein krasses Beispiel sein, aber die Palette von stylischen Lebensmittelfärbungen ist heutzutage so groß, dass man sich fragt: warum spricht alle Welt von Fake News, aber nicht von Fake Food?
Es hilft kein Vertun, ein Malt wie der 14jährige Oban, der ausschließlich in drei-, oder auch viermal zuvor belegten Bourbon Fässern aus nordamerikanischer Weißeiche gereift ist, kann nie und nimmer ein so tiefes Goldbraun ins Glas bringen. Erst wenn ein Whisky länger als 14 Jahre in einem vorbelegten Sherry- oder einem frischen Weißeichefass gereift ist, bekommt er von Natur aus ein leuchtendes Currygold, das sich ganz natürlich bei anhaltender Lagerung in ein Lederbraun verwandelt.
In Oban an der Bar erlaubte ich mir, den Senior mit den strahlend blauen Augen und dem gemütlichen Gesicht zu fragen: „Mal ehrlich, Sir, was soll die chemische Farbe im Whisky?“ Kurz sah er sich um und senkte die Stimme, als vertraute er mir ein Geheimnis an: „Ehrlich gesagt, mag ich dieses Untermischen auch nicht, deshalb rate ich jedem, nur Malts in Cask Strength mit 48 % vol. oder mehr zu trinken, denn caramel wird ja erst beim Verdünnen zugesetzt.“
Das war mal eine ehrliche Antwort und ich spürte, dass wir uns auf der gleichen Wellenlänge bewegten, und so forderte ich ihn auf, sich ein Dram auf meine Kosten zu genehmigen.
„Verehrter Herr, das brauchen Sie doch nicht. Kenner sind mir doch stets willkommen.“
Dem Oban-Pensionär nahm ich dieses Geständnis sofort ab, sein Hantieren hinter der Verkostungstheke sah nach echter Freude an der Arbeit aus. Er schenkte sich ein Gläschen ein und während wir uns zutranken, lockerte er seine Zunge: „Die neuen Besitzer schielen nur nach dem US-Markt. Sie behaupten, die amerikanischen Kunden wollten keine blassen Whiskys und alle Flaschen einer Serie müssten tiptop und gleich aussehen. Ein dunkler Whisky erweckt beim Kunden den Eindruck wie ein goldbrauner Cognac, eben gereift und somit weich, das erzählen uns die Diageo-Leute seit sie Oban gekauft haben.“ Gesagt, getrunken! Als er zum Schluck ansetzte, huschte kurz ein Glanz über seine rosa Wangen. Ja, genüßlich legte er sich seinen Hauswhisky auf die Zunge, schluckte und nickte. Nach einer Pause wischte er sich mit einem karierten Stofftaschentuch die feuchtglänzenden Lippen trocken und erzählte weiter: „Sie müssen wissen, früher fragte keiner nach der Farbe eines Malt. Aus damaliger Sicht muss das heutige Gebaren ziemlich übertrieben wirken! Mein Vater und mein Großvater kauften ihren Hauswhisky noch im Tonkrug. Wirklich, wer hätte damals an so etwas Überflüssiges wie Farbgebung gedacht. Okay, damals ging es mehr um den Geschmack als das Aussehen. Mal abgesehen davon, ging es zu Zeiten meines Großvaters in der Whiskybranche ziemlich rüde zu. Dagegen ist der Zusatz von caramel höchstens so was wie ein Kavaliersdelikt.“
„Was stellten die Leute damals so an?“, wollte ich wissen, meine Neugier war geweckt.
„Ob Sie es glauben oder nicht, in der alten Zeit wurde massenhaft gepanscht, nicht nur beim Whisky. Da natürlich besonders gern, weil man hier gut verdienen konnte! Nicht in den offiziellen Destillerien, aber in den Schwarzbrennereien und beim Händler. Vielleicht ist hier die Quelle für den Zusatz von caramel zu suchen. Sie müssen wissen, dass Whisky damals nur sehr selten in Flaschen verkauft wurde, dafür in offenen Gebinden im Krämerladen. Dadurch boten sich viele Gelegenheiten, scharfen Essig, süßes Glycerin und bitteren Schwarztee, sogar Ätherweingeist unterzumischen, um einen ganz ‚speziellen‘ Whisky der Kundschaft offerieren zu können.“ Der Pensionär lachte und zeigte dabei eine Front tadelloser echter Zähne. Wieder lachte er und schüttelte den Kopf, als konnte er selbst nicht glauben, was er nun erzählte: „Von meinem Vater weiß ich, dass das Panschen bei uns in Schottland eine lange Tradition hat, nicht nur beim Whisky, auch beim Tee, bei Gewürzen und vielen Kolonialwaren, die aus Übersee kamen. Sie glauben ja nicht, was man früher alles machte. Zum Beispiel den importierten indischen Tee streckte man mit getrockneten Escheblättern, ja genau, und in die Butter wurde getrocknetes Schafshirn hineingeschmuggelt und Knochenpulver und Gips ins Brotmehl. So unappetitlich ging es früher bei uns zu. Wenn ich da an das umstrittene caramel denke, erscheint mir dieser Farbzusatz doch recht harmlos, meinen Sie nicht auch?“ Der Pensionär musterte mich mit seinen blauen Augen, dann kam er nochmals auf meine Frage zurück: „Ich glaube, unserem 14jährigen wird caramel zugesetzt, weil Diageo auf dem amerikanischen Markt Erfolg haben muss, sonst müssen wir hier schließen.“

Ich ließ das Thema auf sich beruhen, nahm mir aber vor, bei künftigen Verkostungen stärker auf dem Flaschenetikett nach dem Gütesiegel „Non-chill-filtered and natural colour“ Ausschau zu halten.
Längst war das erste Dram verdrückt und Aroma und Geschmack hatten sich aus Nase und Mundraum verflüchtigt. Nun war die Zeit für einen zweiten Oban gekommen. Aufmunternd und mein Zögern lächelnd niederringend, holte der Pensionär mit seinen großen Arbeitshänden eine Flasche vom obersten Regalboden herunter. „Der müsste Ihnen besser munden“, sagte er beinahe kumpelhaft und schenkte in ein frisches Verkostungsglas einen zweiten 14jährigen Oban ein. „Dieser ist zum Abschluss seiner Reifung in Ex-Bourbonfässern noch sechs Monate im Sherry Cask nachgereift.“
Schon wollte ich nach dem Nosing Glas greifen, da schob er mir eine Karaffe hin: „Nehmen Sie doch erst mal einen Schluck Wasser, das neutralisiert und Sie können dann wieder besser schmecken.“
„Danke, Sir!“ Ich trank einen großen Schluck Leitungswasser, das kühl und erfrischend schmeckte.
In der Farbe unterschied sich der zweite Oban nicht vom ersten, vermutlich war auch er synthetisch dunkler eingefärbt worden. In der Nase kam er allerdings fruchtiger und runder als der erste an und war auch weniger rauchlastig. Am Gaumen entfaltete er sich erstaunlich kühl, schon beinahe minzefrisch, ja, es kam mir vor, als hätte er sogar eine Ingwerknolle berührt. Der Abgang war ein Potpourri aus Holz, Pfeffer und Leder, gefolgt von Malz, und ganz zum Schluss erschienen wie zur Belohnung zarte Noten von Mango, Aprikose und Orange. Dieser Oban hatte mehr als zwei Stützräder verdient – ich gab ihm drei. Allerdings auch nicht mehr, weil er mir persönlich doch zu rauchig schmeckte und weil eine salzig-maritime Note die Süße der Südfrüchte weit hinter sich ließ.
Die zweifache Verkostung hatte die Magensäfte angeregt und geholfen, Müsli, Rührei, Lachs und all die Morgengaben aufzuschlüsseln. Die Leibesmitte war inzwischen schön gewärmt und ich fühlte mich in der Sorglosigkeit meines Ruhetags prächtig. Mit einem herzlichen Händedruck bedankte ich mich bei dem Pensionär, der heftig protestierte, als ich für die beiden Drams bezahlen wollte. Nein, auf keinen Fall, sie gingen auf das Haus. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und steuerte den Abgang über die Eichenholztreppe an und beschwingt verließ ich durch den Shop die Destillerie.
(Fortsetzung folgt)