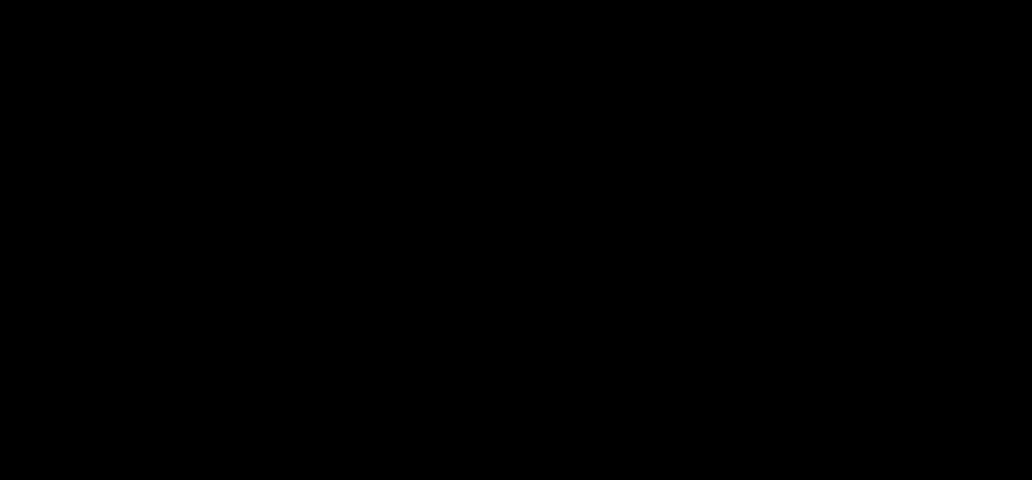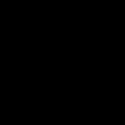Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist im Alba Collection Verlag GbR erschienen. Es kann zum Preis von 19,- Euro hier bestellt werden.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 13)
Whisky Schule
Flink über die Kuppe eines Weidehügels hinweg und wie im Flug eine Allee hinab, deren Baumkronen im Sturm schlingernd tanzten, als liebten sie dieses ausgelieferte Spiel. Schon säumten steingraue Cottages, über Jahrzehnte patiniert, die Straße, auf der ich vor dem Wind das Ortsschild von Campbeltown passierte. Vor den einstöckigen Häusern mit ihren Schornsteinen an den Giebelseiten parkten dicht an dicht schöne neue Autos, die meisten von ihnen deutsche Marken. Als wenig später Kopfsteinpflaster auf mich zugeschossen kam, drosselte ich das Tempo aus Angst vor einem Rahmenbruch. Am Dellwood Hotel an der Tarbert Road begann es plötzlich zu tröpfeln. Ohne lange zu überlegen, hielt ich gleich an und holte den Anorak aus der Satteltasche. Die schüchternen Begrüssungstropfen sollten sich bereits Minuten später als Ouvertüre eines typischen Campbeltowner Dauerregens erweisen, der mich die kommenden zwei Tage begleiten würde. Allerdings sollte dieser Regen in seiner Stetigkeit mir nicht allzu sehr zusetzen, denn die meiste Zeit würde ich mich eh im Trockenen aufhalten.
Gut vorbereitet war ich inzwischen bis weit in den Süden von Schottland, bis an die Südspitze der Halbinsel Kintyre geradelt, um die Springbank Destillerie zu besuchen. Bereits am Ortsschild freute ich mich auf die Begegnung mit dieser legendären Brennerei. Doch zuvor musste ich das Lästigste der ganzen Reise hinter mich bringen, ich musste einen Rückzugsort finden, wo ich am Abend mein Haupt zur Ruhe betten konnte.
Gemächlich in die Pedale tretend, fuhr ich auf einem tausendfach geflickten Asphaltteppich ins Ortszentrum hinein, vorbei an der neuerbauten Bibliothek mit dem Hallenbad und dem Gemeindezentrum. Ab hier schaute ich mich in alle Richtungen um. Ich suchte Einheimische von der Straße, die mir einen Übernachtungstipp geben könnten, eine handfeste und reale Empfehlung und keinen mit Photoshop aufgehübschten Internet-Tipp. Doch keine Menschenseele war im Regen unterwegs. Ab und zu zuckelte ein Auto, dessen Scheibenwischer sich schneller bewegten als sein Antrieb, an mir vorbei ohne anzuhalten. Vital waren nur die hin- und herfliegenden Möwen, die sich mit Scharen von Krähen und Tauben um die Abfälle aus aufgerissenen schwarzen Müllsäcken balgten.
Über die Hafenpromenade, deren viktorianische Gebäude sich über drei Stockwerke emporschwangen, war eine Glocke der Melancholie gestülpt, die auch mich im Vorbeiradeln erfasste, weil ich gelesen hatte, dass Campbeltown vor hundertfünfzig Jahren dank seiner vielen Brennereien, seiner Heringsflotte und seiner Kohlevorkommen prosperiert und einer Menge Bürger zu Wohlstand und einer pulsierenden Heimat verholfen hatte. Damals waren Campbeltowns schwere Torfwhiskys eine echte Konkurrenz zum irischen Whiskey, der wohl der Urvater aller schottischen Single Malts ist. Mit Wehmut im Herzen über die Melancholie im Hier und Heute, trat ich fünf Minuten vor der Mittagspause in den gut beheizten Raum des örtlichen Touristenbüros auf der leergefegten Mole.
Als ich mich in dem Büro zwischen Prospekt-Regalen umsah, gewann ich den Eindruck, dass es nur noch eingefleischte Whiskyfans hierher verschlug, um die traurigen Überbleibsel eines alten Gewerbes zu besichtigen, vielleicht auch noch den einen oder anderen Malt zu kaufen und schnell wieder zu verschwinden. Mit Bedacht, um die Büroruhe nicht zu stören, näherte ich mich der hohen Theke an der Rückwand des überheizten Raums. Wie ertappt sprang ein grauhaariger, hagerer Schotte von seinem Bürostuhl hinter der Theke auf und rief sehr laut und hastig: „Welcome! Sie suchen sicher eine Accommodation im Ort, warten Sie, gleich kann ich Ihnen mit einer ganzen Liste dienen.“ Überaus beflissentlich reichte mir der Senior, der gewiss ehrenamtlich hier arbeitete, ein Blatt mit an die zwanzig Adressen, die nicht bröseliger hätten kopiert sein können.
Irritiert sah ich auf das Allerlei der aufgelisteten Adressen, die einem Fremdling nichts, aber auch gar nichts sagten. „Wie soll ich was Passendes finden, ich kenne mich hier doch gar nicht aus! Können Sie mir nicht ein Quartier empfehlen und für mich dort anrufen, ob was frei ist?“
„Gerne, das kostet Sie aber 4,50 Pfund.“
„Wie bitte? Soviel!“
„Ja, leider, das hat das Ministerium so festgelegt“, sagte der Senior peinlich berührt.
„Dann suchen Sie mir doch ein B&B in der Nähe von Springbank raus, ohne dass Sie dort anrufen müssen. Dann könnte ich doch Geld sparen, verstehen Sie?!“
„Okay, kein Problem, hier“, er malte ein Kreuz auf den Ortsplan, „an der Union Street gibt es ein günstiges B&B für 46 Pfund die Nacht.“
„Thank you!“ Gewissenhaft faltete ich die Liste zusammen, steckte sie in die klamme Anoraktasche und trat in den Nieselregen hinaus. Unter dem weit vorragenden Dach der Hafenmeisterei war es trocken und dort stand auch eine weiße Bank, auf die ich mich setzte und überlegte. Nachdem ich ein wenig verschnauft hatte, sah alles schon besser aus. Ruhig holte ich mein Handy aus der Anoraktasche und gab in die TomTom Karte die angekreuzte Adresse von der Liste ein. Und siehe da, ganz in der Nähe, keine 500 Meter von meinem Standpunkt entfernt, nur die Hauptstraße hoch und die erste Seitenstraße nach rechts, dann noch fünf Häuserblocks weiter, war das empfohlene B&B an der Union Street markiert. Mit einem Seufzer über den nun strömenden Regen stieg ich wieder aufs Rad und fuhr die kurze Strecke durch zwei menschenleere Straßen. Da ich ein gutes Ortsgedächtnis habe, fand ich ohne Vertun das besagte Quartier. Für 40 Pfund nahm ich das Zimmer, das sogar über ein zweites Bett, eine winzige separate Duschkabine und das obligatorische Set aus Wasserkocher, Teeservice, Beuteltees, Nescafe, Cream und zwei abgepackte Küchlein verfügte. Mein Rad durfte ich durch ein Mauertürchen in einen mit vermoosten, würzig riechenden Drahtreusen und Schiffstauen vollgestopften Hinterhof schieben und dort einstellen. Mir war klar, dass ich das Rad bis zu meiner Abreise am übernächsten Tag nicht mehr anrühren würde, denn das Zentrum von Campbeltown ist so klein, dass man alle Wege zu Fuß zurücklegen kann.
Ohne viel Zeit mit meiner redseligen Wirtin zu verbringen, schloss ich mich in meinem Zimmer ein, warf die Gepäcktaschen auf das freie Bett am Fenster und meine Wenigkeit auf das Nischenbett daneben. In der Ruhe meiner Abgeschiedenheit übermannte mich der Schlaf – immerhin war ich am Vormittag knapp 60 km „geflogen“.
Im feuchten Anorak trat ich dann gegen 15 Uhr auf die regennaße Union Street hinaus und blinzelte in den steingrauen Himmel. Noch immer nieselte es, aber das scherte mich nicht. Guter Dinge und vom Mittagsschläfchen erfrischt, spazierte ich um die Ecke und keine hundert Meter weiter baute sich das Objekt meines Hierseins auf. Aus meinem Zimmer hatte ich bereits das Firmenschild „Springbank, Longrow, Hazelburn, Campbeltown Malts“ an der Hauswand über dem Fabrikeingang der Brennerei Springbank erblickt. Der Weg durch eine überaus enge Zufahrt war selbst für einen Blinden zu finden, denn zwischen den Fassaden roch es süßsauer nach Most und je näher ich kam, desto säuerlicher waberten Ausdünstungen zwischen den Backsteinwänden. Mittlerweile waren mir diese Gerüche im Umfeld einer Destillerie vertraut, befremdet war ich allerdings vom Qualm, der in fetten schwarzen Schwaden aus einem Schornstein quoll. So beizend stieg er in die Luft, dass ich beim Näherkommen husten musste. In der ganzen Umgebung roch es recht unappetitlich nach verbranntem Kompost. Laienhaft konnte ich nur vermuten: hinter den alten Mauern wurde gerade ein Feuer aus qualmenden Torffladen angefacht.

Beim Passieren des Fabriktors wurde mir schnell klar, was die gern zitierte Faszination von Springbank ausmachte: das Altehrwürdige und Traditionelle der Destillerie mitsamt ihrer Gebäude, die noch aus jeder Mauerritze die Pionierzeit des Whiskymachens atmeten. Unberührt vom technischen Schnickschnack moderner, antiseptischer Großbrennereien praktizierte man hier die Destillation von hochprozentigen Tropfen, die ja im Prinzip nichts anderes ist als das Scheiden von Wasser und Alkohol mit Hilfe von Feuer – stilla wie der Lateiner sagt. Dieses Trennen beherrschen alle Kulturen nicht erst seit gestern, sondern seit über tausend Jahren. Und trotzdem ist dieses Trennen bei Springbank etwas Besonderes, denn hier praktiziert man das Destillieren, das „Herabtröpfeln“ des Alkohols, noch wie zu Urgroßvaters Zeiten. Schon bald würde ich Zeuge werden, wie viele geübte Hände und wenige altertümliche Apparaturen ein köstliches Elixier ins Leben holten.
* * *
Per Internet hatte ich mich für den einwöchigen Kursus der „Springbank Whisky School“ angemeldet – so zumindest lautete mein Plan, den ich hierher übermittelt hatte. Meine Anspannung wuchs, als ich den Fabrikhof überquerte. An einem geparkten Farmertraktor mit tuckerndem Motor kam ich vorbei und näherte mich langsamen Schritts einem Gebäude, dessen Fassade aussah, als hätte sie seit dem Gründungsjahr 1828 keinen auffrischenden Anstrich mehr erhalten. Erwartungsvoll betrat ich das einstöckige Office. Im Inneren erstaunte mich, wie putzig klein, wie altmodisch, wie unaufgeräumt und vollgestellt mit Bergen von Flaschenkartons die administrativen Räumlichkeiten der Brennerei waren. Im Büro wurde telefoniert, diskutiert und über drei Schreibtische hinweg beratschlagt. Ich trat an den Empfangstresen heran und stellte mich mit Namen und Nationalität vor und erwähnte auch den Email-Kontakt. Die ältere Empfangsdame in karierter Wolljacke schaute mich eindringlich über den Brillenrand an und freundlich lächelnd sagte sie: „Sehr angenehm. Willkommen bei Springbank. Ja, die meisten unserer Schüler, wenn sie nicht gerade aus England oder Nordamerika kommen, sind Deutsche wie Sie. Warten Sie einen kurzen Moment.“ Sie rief mehrere Dateien auf, fand meine Email aber nicht im Computer. „Tut mir leid, aber ich finde Ihren Namen nicht in der Liste unserer Schule. Am besten Sie gehen rüber ins Visitors Center und buchen eine Tour.“
Ziemlich enttäuscht über die routinierte Abfertigung nickte ich ergeben und verschwand wortlos durch die Schwingtür mit ihren geätzten Fensterscheiben.
Visitors Center! Dieser Begriff entpuppte sich als ziemlich hochgestochen, etwa so wie wenn eine Dorfwirtschaft ihr Hinterzimmer als Event Location ausgibt. Im schummrigen Raum, wo die Renovierung gerade pausierte, standen zwei splitternackte Schaufensterpuppen herum, neben denen Jacken mit Springbank-Logo auf einem Pappkarton lagen. Entlang der Stirnwand erhob sich eine deckenhohe Vitrine, hinter deren Glasflügeltüren museale Erzeugnisse in dunklen und hellen Flaschen standen. Staunend stand ich vor der Springbank, Longrow und Hazelburn Flaschenvita und verliebte mich sofort in die ältesten Exemplare, deren nostalgische Etiketten die Glasflaschen zu Kunstwerken stilisierten. Die Exponate hinter Glas mussten einen Seltenheitswert besitzen, nur mit viel Glück und Geld könnten sie noch in Auktionen ersteigert werden, dachte ich beim Betrachten der raren Schätze. Später sollte ich erfahren, dass ein chinesischer Sammler für einen 1919er Springbank umgerechnet 63.000 Euro bezahlt hatte. Um so mehr verwunderte mich, dass der Schlüssel zur Vitrine steckte und auch der Raum für jeden Fremden zugänglich war. Leicht hätte ein Dieb eine oder mehrere seltene Flaschen stibitzen und sie über das Internet teuer verkaufen können. Bereits bei Ardbeg und Laphroaig war mir die Sorglosigkeit in den Visitors Centern aufgefallen.
Unter den exklusiven Malts entdeckte ich den Da Mhile von 1992, der als erster organic whisky der Welt gilt. Ein Biofarmer aus West Wales hatte seine biologisch-dynamisch angebaute Gerste zu Springbank gebracht, um sie hier destillieren zu lassen. Als ich eine Flasche erwerben wollte, sagte man mir, dass der Farmer die Fassreifung, die Abfüllung und den Vertrieb inzwischen in die eigene Hand genommen hätte. Aus dem Internet erfuhr ich dann später, dass sich die englische Biofarm von damals zu einer eigenständigen Brennerei namens Da Mhile entwickelt hatte und heute für feinsten Gin berühmt ist.

Beim weiteren Erkunden des Besucherraums entdeckte ich neben der Vitrine das Farbfoto eines streng dreinblickenden, graubärtigen Gentleman in Tweed und gelber Weste. Das Bild zeigte den Patriarchen Hedley G. Wright. Dem hageren alten Gesicht konnte man ansehen, dass dieser Mann ein bewegtes, nicht immer erfolgreiches Geschäftsleben hinter sich gebracht hat. Im Jahr 1979 hatte Springbank schließen müssen und erst 1989 wurde die veraltete Anlage ohne nennenswerte Investitionen wieder eröffnet. Manch einer der Angestellten hielt das für eine von falscher Sparsamkeit getragene Entscheidung des Patriarchen. Und trotzdem spricht man unter den siebzig Mitarbeitern voller Respekt über den unsichtbaren Seniorchef, der wohl in Edinburgh residiert, so genau weiß das keiner, weil Hedley G. Wright mehrere Landsitze sein Eigen nennt.
John, ein altgedienter Vorarbeiter, sollte mir später erzählen: „Mister Wright kennt sich mit dem Whiskymachen aus wie kein Zweiter, er hat das Handwerk vom graver auf gelernt.“
„Graver?“, fragte ich nach, „Was ist das?“
„Graver ist der Mälzrechen, mit dem man die angefeuchtete und keimende Gerste auf dem Malzboden ausbringt.“ Ohne Übertreibung, Vorarbeiter John mochte ein gewiefter Fuchs an der Destille sein, aber als Guide eignete er sich nicht, denn er sprach wie ihm der gälische Schnabel gewachsen war und ich kam mir vor wie ein Ostfriese, auf den ein Schweizer in gurgelndem Schwyzerdütsch einredet. Mit einem Schmunzeln erzählte er mir dann folgende Geschichte über seinen alten Chef: „Vor vielen Jahren haben wir im Lagerhaus das Fass eines fünfzehnjährigen Malts kontrolliert. Als wir das Spundloch öffneten und mit dem Heber eine Probe zogen, sind wir regelrecht erschrocken, weil die Probe schwarz ins Glas floss. Keiner verstand das Problem, verdattert filterten wir den Malt, doch das half auch nichts, der Malt blieb schwarz, wirklich, rabenschwarz. Selbst wir alten Hasen wussten uns nicht zu helfen, sowas hatte noch keiner von uns erlebt. In unserer Not telefonierte ich mit Mister Wright und er machte einen ziemlich verrückten Vorschlag. Wir sollten drüben im Tesco-Markt einen Liter Schafmilch kaufen und die Milch ins Fass kippen. Was war das für ein verrückter Ratschlag? dachten wir und sahen uns verwundert an, schickten aber dann doch einen Lehrling los und taten wie uns geheißen. Prompt klärte sich der Malt innerhalb von zwei Tagen und wir konnten ihn ganz regulär filtern und in Flaschen abfüllen. Lange noch rätselten wir, wie es zu der Verfärbung gekommen war. Vermutlich hatte über all die Jahre ein Eisennagel oder ein Metallstück im Fass gelegen, das der Küfer beim Ausbessern der Dauben vergessen hatte. Wie gesagt, mit der Kritik am Patriarchen muss man vorsichtig sein. Mister Wright ist noch einer von der alten Schule, der einen Malt auch auf einem Camping-Kocher machen kann.“