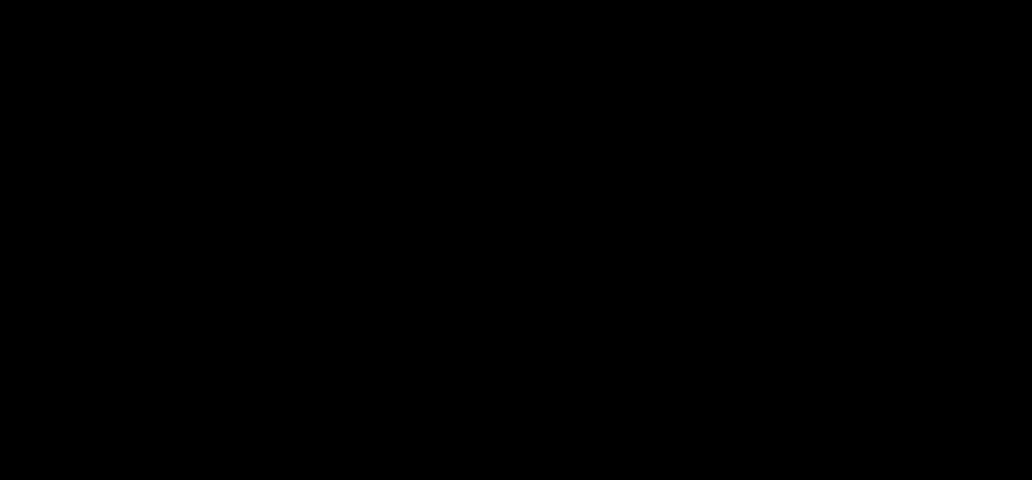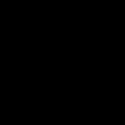Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 24)
* * *
Ein neuer Tag, ein neues Reifenspiel. Wieder für Stunden folgte ich dem grauen Band über Hügel und um Hügel herum sowie durch Senken und über Flüsse und Bäche. Oft wirkten die langgestreckten, sanft daliegenden Hügel wie eine Großfamilie, deren Zusammengehörigkeit nur durch die A 816 gestört wurde. Nun ja, mit diesem Zerteilen und Zerstückeln des Naturgefüges, was man auch Infrastruktur nennen kann, durfte ich nicht hadern, denn auch ich profitierte davon. Hatte ich mal wieder einen Bergrücken erklommen, lag das Asphaltband inmitten der grünen Weite wie ein regloses, schwarz geschupptes Reptil, das sein kaltes Blut in der Sonne wärmte. Aber als harmlos erlebte ich den gewundenen Straßenverlauf leider nur aus der Entfernung – aus der Nähe wurde ich der Gefahr gewahr, die von ihm ausging.
Des Nachts wurden regelmässig an Wildwechseln querende Tiere überfahren. Mit verdrehten Köpfen und aus dem Maul blutend, lagen zwei Rehe in der Böschung, und beim Vorbeifahren weckten ihre gebrochenen Blicke eine große Traurigkeit in mir. Aber auch Wut auf die Temposünder, die sich einen Dreck darum scherten, dass alle 500 Meter in großen weißen Buchstaben „slow“ auf den Asphalt geschrieben stand. Selbst wenn in der Grafschaft Argylle and Bute ein dichter Wildbestand herrschte, hätten die beiden Rehe nicht zu Tode kommen müssen. Auch nicht die Igel, Füchse und Marder, deren verwesende Kadaver traurige Zeugen einer über Landesgrenzen hinweg herrschenden time-is-money-Mentalität waren.
Im Gegensatz zu mir lenkten die Chauffeure ihre Autos schnell, womöglich sogar gasgebend, an den toten Tieren vorbei. Sie mochten die Toten im Moment des Vorbeifahrens betrauern, aber mir, in meiner Langsamkeit, blieb der Blick auf den Tod viel länger als ihnen erhalten. Die sich dehnende Zeit der Annäherung, des Heranfahrens, des Vorbeifahrens und des wehmütigen Weiterfahrens schmerzten doch in der Seele sehr. Das einzig Gute des erschütternden Anblicks war, dass er mein Bewusstsein für den lebenserhaltenden Umgang mit Tieren weiter schärfte.
Am 13. Mai begrüsste mich Oban[1] mit Tankstellen, Autohäusern, KfZ-Werkstätten und Supermärkten, eben mit Konsumstätten des scheinbar Unentbehrlichen. Nach meiner Zeit in der Natur schnürten mir die dicht an dicht gedrängten und ineinander verkeilten Gewerbebauten die Kehle zu, und ich kam mir im geballten Stadtverkehr wie ein verirrter Jedi Ritter aus einer fremden Galaxie vor. Natürlich hätte ich mich dem Gewimmel verweigern, die Stadt großräumig umfahren und die Landflucht antreten können. Aber die Hafenstadt Oban wollte ich kennenlernen. So stemmte ich mich nicht gegen Lärm und Hektik, sondern ordnete mich geschmeidig in den motorisierten Verkehr ein, indem ich mir meine Zerbrechlichkeit eingestand, bescheiden am Rand des brüchigen Asphalts fuhr und mein Tempo dem Verkehrsfluss anpasste. Weit nach links dirigierte ich das Rad, gefährlich nahe an den Rinnstein, und niemals ließ ich die Bremsen los, weil ich stets mit einem Rempler oder Sturz rechnen musste. Gute zwei Kilometer neigte sich die Straße zur Bucht hinab, und dabei wirkte die Dynamik des Autoverkehrs wie ein Sog, der mich erst wieder an einem Verkehrsrondell im Hafen freigab.
Oban ist der kleine Bruder von Edinburgh, auf keinen Fall die Schwester. Edinburgh wird gekrönt von einem düsteren Schloss auf einem abgeschliffenen Vulkanfelsen, hingegen Oban von einem kolossalen Steinring, der wie eine durchlöcherte Krone auf dem Stadthaupt sitzt. Mit ihren ehrwürdigen Gebäuden mit Erkern, Türmchen, Treppengiebeln und Granit- und Sandsteinfassaden aus zwei Epochen, der gregorianischen (1720-1840) und der viktorianischen (1840-1901), zeugen beide Urbanitäten von maskuliner Kraft. Die kantigen, mit kohlschwarzen Schlieren tätowierten Steingesichter der Ufergebäude Obans erschienen unter den tiefhängenden Wolken bedrohlich abweisend, mit ihrer Patina gar wie kriegsbemalt. Sowohl die Stadtgründer, als auch der große Glasgower Architekt Charles Rennie Mackintosh hätten niemals gedacht, dass Seeklima, saurer Regen und Abgasnebel den Fassaden derart tiefe Wunden und Scharten zufügen könnten. Nun lebten und wirkten diese Architekten vor vielen Jahrzehnten, ich aber stand an der Hafenpromenade, und wie ich mich umsah, erblickte ich nur aristokratische Gebäude, deren Fassaden dringend einer Hochdruckreinigung bedurft hätten.
Oban kam mir wie ein gestauchtes Edinburgh vor, eine kleine Stadt, die recht ordentlich mit ihrem eingezwängten Dasein zwischen Hanglage und Wasserkante zurecht kam. Trotz der Enge verbuchte sie ein gehobenes, sogar weltmännisches Flair, wozu alte Hotels wie das Alexandra an der Esplanade beitrugen. Leider wird Obans ehrwürdige Erscheinung wie auch Edinburghs Ehrwürdigkeit von einer architektonischen Verwirrung getrübt – bei Edinburgh ist es ein in die Talsohle gepresster Bahnhof, der auch ein gigantisches Gewächshaus sein könnte. Bei Oban ist es eine Shopping Mall mit einem gläsernen Hüttendorf auf der erweiterten, ins Meer vorgeschobenen Mole.
Nach Oban war ich gekommen, um zu pausieren, einen Tag lang mein Sitzfleisch zu regenerieren, fisch & chips zu probieren und auch den lokalen Whisky, den Oban. Natürlich stand auch eine gemütliche Sightseeing Tour per pedes auf dem Programm.
Ohne Frage hat Oban sehenswerte Ecken, als erstes wäre da das McCaig’s Rondell auf dem Hügel zu nennen. Ein Steinring, der mit seinen durchbrochenen Bögen wie das Relikt eines römisches Kolosseums aussieht. Auf der Suche nach einem Quartier kam ich daran vorbei und konnte mir den nie fertiggestellten Turm aus nächster Nähe ansehen.
Der Wunsch für zwei Übernachtungen ließ in der Regel den Landlord aufhorchen, denn für das doppelte Geld brauchte er nur einmal das Bett frisch zu beziehen und die Handtücher zu wechseln. Leider sind in Oban die Landlords allesamt sehr verwöhnt, denn die Stadt mit ihren 8.500 Einwohnern ist ein Touristenmagnet. Von hier verkehren die Autofähren zu den Hebriden, und die Hafenstadt gilt als Sprungbrett zum Grant Glen.
Als Obdachsuchender schob ich also mein Rad den Hügel zur Stadtkrone hinauf, weil ich mir oberhalb des Zentrums eine preiswerte Unterkunft mit Aussicht erhoffte. Die steil aufwärts führende Rockfield Road marschierte ich, vorbei an schmalen Säulenportalen und handtuchgroßen Vorgärten, von Tür zu Tür. Ja, ich klingelte an vielen der pistaziengrünen Haustüren, selbst an Türen, an denen das Schild „No vacancies“ hing. Mit jeder Abweisung wurde ich panischer, denn schon wieder ging es auf den Abend zu. Verschwitzt und nach vollbrachter Pedalarbeit rechtschaffen müde, fragte ich mich tatsächlich den ganzen Hügel hinauf bis dicht unter den McCaig’s Tower.
Nachdem ich auf der oberen Terrasse jedes, aber auch jedes Gästehaus abgeklappert hatte, klingelte ich ohne die geringste Hoffnung an einer buntbemalten Hippie Tür, neben der im Fenster ebenfalls jenes verflixte Schild hing. Unüberlegt, wohl nur aus Nostalgie, klingelte ich an dieser bunten Tür, hinter der sich lange nichts regte. So hatte ich genügend Zeit, über die Pfeilspitzen eines Gusseisenzauns in das verwilderte Paradies aus Primeln, Farnen, schaukelnden Gräsern und einem Gerank von Heckenrosen und wildem Wein zu schauen.
Endlich wurde der Hausschlüssel umgedreht und heraus trat der Landlord, so armselig gekleidet, dass ich erschrak. Von wegen Lord! Schon eher ein bedürftiger Rentner, der seine Kleider bei Oxfam billig erstanden haben musste. In einem mausgrauen, dünngewaschenen Pulli und einer geflickten Schlabberhose trat er freundlich lächelnd auf mich zu. Sein hageres Gesicht versteckte er hinter einem Fisselbart und einer runden Nickelbrille, die ihm schief auf der Nasenspitze hing. In überraschend kultivierter Wortwahl erkundigte er sich nach meinem Begehren.
„Hallo, Sir! Vielleicht haben Sie doch noch ein Zimmer für einen Radfahrer aus Deutschland für zwei Nächte frei? Nun ja, könnte ja sein…“ Achselzuckend zeigte ich auf das Schild „Sorry, no vacancies“ im Fenster und sah ihn flehend an.
„Sorry, very sorry!“, erwiderte der alte Herr so jammervoll, dass er mir schon leid tat. „In Oban gibt es zu wenige B&B und auch zu wenige Hotels und Pensionen, I am so sorry, very sorry!“ Der alte Mann entschuldigte sich so devot, als hätte ich ihn bei einem Ladendiebstahl ertappt. Während er sich an einem fort für den Misstand bei ihm und in Oban, womöglich in der ganzen Welt, entschuldigte, fuhren seine knochigen Finger nervös durch das schüttere Haar, als suchten sie dort nach einem Ausweg aus der Misere.
Nach dieser und sich wiederholenden Begegnungen war mir endgültig klar, dass Bed & Breakfast-Vermieter keine verkappten Millionäre sind, sondern von den saisonalen Einnahmen ein ganzes Jahr lang leben müssen. Das erklärte auch, warum dieser feine alte Herr so ärmlich gekleidet in der Tür seines Hauses stand und sich für vieles schämte. Ich heuchelte Verständnis und schob mein Rad einige Yards weiter zum nächsten B&B in derselben Straßenzeile.
Auf dem Weg ärgerte ich mich kurz, hätte ich doch digital zwei oder drei Tage zuvor ein Zimmer gebucht. Aber das Reservieren von unterwegs hatte ich unterlassen, weil ich gleich zu Reisebeginn eine lausige Erfahrung mit einer Internetbuchung gemacht hatte. Bei airbnb hatte ich noch von daheim für meine ersten Edinburgher Tage eine Unterkunft gebucht und wie üblich gleich mit Kreditkarte bezahlt. Bei der großen Auswahl an privaten Quartierangeboten hatte mich das farbige Abbild eines noblen Zimmers, lichtdurchflutet mit Klavier und Ledersesseln, zu eben dieser Vorabbuchung verleitet. Aber kaum, dass ich dort eingecheckt hatte, wurde mir von der Vermieterin klargemacht, dass ich dieses schöne Klavier- und Sesselzimmer nicht betreten dürfte, weil dieser Raum ihr Refugium sei. Dafür musste ich mich in einem Schuhkarton voller ausrangierter Möbel und Nippes und einem mit Silikon winddicht verklebten Schiebefenster (O-Ton der Vermieterin: „Noch nie wollte ein Gast das Fenster öffnen“) zufrieden geben. So hatte ich mich nach dem airbnb-Reinfall auf die gute alte Methode besonnen, die Unterkunft vor Ort auf Herz und Nieren zu prüfen. Oft ist es doch so, dass allein sinnliches Erleben Irrtümer und Fehlentscheidungen verhindert, denn alles andere um uns herum existiert doch nur als Begriff. Also gab ich die willentliche Suche auf und überantwortete mich der Intuition – und prompt landete ich in der örtlichen B&B Straße, die parallell zur Hafenpromenade verlief.
An einem kirschroten Porsche Cayman lehnte rauchend ein Typ, der seinen tätowierten Arm auf dem Autodach platziert hatte, so bestimmend, als wollte er allen zeigen: seht her, das Teil gehört mir! Der Typ war in einer angeregten Unterhaltung mit einem anderen Typ vertieft, der schwarze Trainingshosen mit weißen Streifen trug und dessen Haarsträhnen gefönt und mächtig gestylt, aber weniger blond und weniger rasant toupiert waren als beim Mann mit dem Arm auf dem Porschedach. Dafür spielte er andauernd mit einem Schlüsselbund als sei der metallene Bund eine Gebetskette. Beide standen breitbeinig neben dem parkenden Sportwagen, als gehörte ihnen nicht nur der teure Wagen, sondern die ganze Straße. In meiner Verzweiflung redete ich mir ein, dass diese Männer einflussreich sein müssten und mir irgendwie zu einem Bett verhelfen könnten. Auf gut Glück sprach ich den Porsche-Typ mit der rotblond toupierten Frisur an: „You drive a wonderful car!“
„Yeah, a German car!“
„I’ m German, can you perhaps help me?“
So wogte die Unterhaltung einige Sätze hin und her, der toupierte Rotblonde wollte mir sein Auto erklären, ich hingegen wollte nur ein Zimmer. Mein Bedürfnis interessierte ihn erst, als er mir mitgeteilt hatte, dass er sieben Porsche und mehrere Hairsalons besass.
„Ob er auch ein Guesthouse sein eigen nenne?“, fragte ich nun schon erwartungsvoller.
„Klar! Sogar zwei!“
Mein Herz machte einen Satz und gleich wollte ich wissen, ob darin nicht ein Zimmer frei sei? Unvermittelt keimte Zuversicht in mir auf.
Dafür müsse er seine Frau fragen. Mit einem Augenzwinkern fingerte er ein großes Smartphone aus der Gesäßtasche seiner Jeans, Marke destroyed, und rief überraschend geschäftig eine gespeicherte Nummer an. Doch niemand ging ran, allerdings legte er auch porscheschnell gleich wieder auf. Kurz zog er die Stirn kraus und besann sich auf eine andere Methode. Wortlos und resolut winkte er mir, ihm ohne große Fragerei zu folgen. In seinem Schlepptau überquerte ich, das Rad an meiner Seite, die ruhige Wohnstraße mit den Aushängeschildern mehrerer B&B. Keine zehn Meter weiter betraten wir einen Hauseingang und standen vor einer Parterre-Wohnung, aus deren sperrangelweit geöffneter Tür Kindergeschrei schwappte. Wie wir zusammen eintraten, krabbelten drei Babys wie kleine Planierraupen zwischen Plastikspielzeug herum, das den flusigen braunen Teppichboden bunt gesprenkelt bedeckte. Zwei junge Mütter fläzten rauchend und ratschend auf einer Sofagarnitur und lackierten sich gegenseitig die Nägel. Ihre Schmollmünder waren porscherot geschminkt und die Pickel ihrer Jugend dick überpudert. Nach ihren frechen Dekolletés zu schließen, hatten sie noch etwas Verlockendes vor. Herrisch fragte der Friseursalonbesitzer eine der Frauen etwas in einem Slang, von dem ich keine Silbe verstand. Wie auf Kommando händigte sie ihm einen gewaltigen Schlüsselbund aus und wieder winkte er mir, ihm wie ein Dienstbote zu folgen. Wir liefen hintereinander keine fünfzig Meter die B&B Straße hinab und standen nun vor einem dreistöckigen Haus, dessen Fassade schon mindestens zwanzig Jahre auf die besagte Hochdruckreinigung wartete.
(Fortsetzung folgt)
[1] oa-bun „Kleine Bucht“