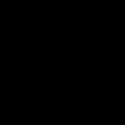Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 29)
Zwei Optionen boten sich nun an: entweder dem vergilbten Fahrplan zu vertrauen und drei Stunden auf das Fährboot zu warten, in der Hoffnung, dass es wirklich kommt. Oder mich von den äußeren Umständen unabhängig zu machen und einen Umweg von 30 Kilometern in Kauf zu nehmen, wohlwissend, dass dieses Unterfangen sehr anstrengend werden würde. Natürlich könnte ich verweilen, versunken in die Betrachtung meines aufragenden Gegenübers, des Bergs. Auch hätte ich Zeit und Muße, um in meine Notizen zu investieren, zum Beispiel in Aufzeichnungen über den Flow.
Schließlich wurde die große Biegung an Loch Linnhe und Loch Eil zum Scheidepunkt, an dem zwei Arten der Fortbewegung aufeinanderprallten: Flow und Speed. Den Flow hatte ich gerade erlebt, den Speed sollte ich ab jetzt erleben, weil ich mich für die Umfahrung entschloss – und zwar mit Tempo und zweckorientiert mit klarer Zielvorstellung. Noch vor Anbruch der Dunkelheit wollte ich drüben in Fort William sein, wofür ich die 30 Kilometer in kräftezehrendem Stakkato hinter mich bringen musste.
Beide Formen des Radfahrens, Flow und Speed, sind reizvoll und wert, sie gleichermaßen kennenzulernen. Jeder Fernradfahrer und natürlich jeder Rennradfahrer, der konditionell gut in den Pedalen ist, kennt den Zustand von speedy. Nach außen hin geht es ums Tempo, im Wesen hingegen um mehr, um eine körperliche und geistige Herausforderung, die sich in einem höheren Pulsschlag und einer größeren Schlagkraft zeigt, was zweifelsohne ein erhebendes Gefühl von Leichtigkeit und Glück im Körper bewirkt. Dabei kann es leicht passieren, dass man unter Speed die Herrschaft über seine Sinne verliert. Vor lauter Euphorie schießt man dann über das Ziel hinaus und schon schnappt die Falle zu, die Falle einer mentalen wie körperlichen Selbstüberschätzung. Jetzt wird der Speed zum Selbstzweck und das Erreichen des Ziels zu einer verbissenen Idee, die sich leicht vom Begehren zur Begierde und zur Gier auswachsen kann und folglich jeden Gedanken an Verweilen und Muße als störend wegdrückt. Jetzt ist der Speed nicht mehr förderlich, wenn die Radtour, der Run und überhaupt jeder Walk nur noch reflexiv vorangetrieben und selbst das richtige Atmen vernachlässigt wird. All das erlebte ich, als ich anstelle des So-Seins, das zweckbetonte So-Wollen wählte, mich in die Pedale stemmte und den schmalen, langgestreckten Loch Eil immer im Angesicht des anderen Ufers umfuhr.
Anfangs freute ich mich über viel Rückenwind, aber kaum, dass ich am verlandeten Ende in großem Bogen auf der geschäftigen A 830 zurückfuhr, stand er mir im Gesicht und stemmte sich gegen meine Brust, als wollte er mein Zielverlangen sabotieren. Erschöpft erreichte ich gegen 19 Uhr den Ortseingang von Fort William, wo ich am erstbesten Minimarkt anhielt und mit zittriger Hand eine Flasche Wasser, einen Joghurt und ein eingeschweißtes Sandwich kaufte. Als sich mein Körper langsam erholte, musste ich kleinlaut zugeben, dass ich das Prinzip des Loslassens noch nicht verstanden hatte.
Sobald die Hitze aus Kopf und Körper verschwunden war, querte ich den Caledonia Canal auf einem Eisensteg und schneckengleich fuhr ich erschöpft bis vor das Postamt in der Fußgängerzone der Kleinstadt. Bunte Plakate in den Schaufenstern kündigten die Wandersaison am Ben Nevis an. Zum Glück hatte sie noch nicht begonnen, so fand ich ohne große Sucherei ein B&B im Wohngebiet an der oberen Hangterrasse. Der kleine Herbergskomfort bestand aus einem scharlachroten Teppichboden und einem zweiten Bett, auf dessen Tagesdecke ich mein Gepäck abladen und frisch ordnen konnte. Mit der Duschapparatur hatte ich mittlerweile Frieden geschlossen und wurde dafür mit Heißwasser im Überfluss belohnt.
Am nächsten Morgen mampfte ich wieder tüchtig und steckte mir auch zwei Äpfel und zwei Dreieckstoasts mit Orangenmarmelade auf salziger Butter ein. Als es ans Bezahlen ging, kam ich mir wie ein Wohltäter vor, weil ich der jungen indonesisch-schottischen Familie, die während der Sommersaison von ihrem Haus in die Enge eines Wohnwagens umgezogen war, einen Obolus von 60 Pfund auf den Frühstückstisch legte.
Wieder ein Sonnentag, noch kühle Frische in der Früh, aber T-Shirt Wetter am Nachmittag! In den Morgenstunden erlebte ich eine Schattenfahrt über querliegende Wurzelschlangen auf weichem Weg. Die dichte Bewaldung ringsum bewies, dass die Highlands nun zu meiner Begleitung gehörten wie der Luftdruck zum Reifen. Seit Verlassen der Auen und dem Eintauchen in einen Wald mit verfilztem Buschwerk unter hohen Tannen und Kiefern lud Trail No. 78 auch Hiker ein, nach Fort Augustus am Südzipfel von Loch Ness zu wandern.
Ein gemächlicher Fahrtag mit vielen Trinkpausen war angesagt, mehr als definitiv: ein Fahrtag ohne Speed. Der Verzicht aufs Tempo fiel nicht sonderlich schwer, denn der ganze Körper fühlte sich an wie eingeklemmt in einer Eisenrüstung. Obwohl ich am Vorabend noch die Hüftbeuger gedehnt und Rumpf und Rücken auf dem mitgebrachten Yogatuch gestretcht hatte, strengte das Pedalieren auf holprigem Waldgrund derart an, dass ich nur kleine und mittlere Gänge wählte. Die gestrige Speed-Aktion hatte mir einen feinen Muskelkater mit Brennen in den Oberschenkeln, eine verkrampfte Wadenmuskulatur sowie einen schmerzenden Nacken beschert. Auf dem harten Sportsattel verspürte ich auch eine leichte Wundreizung am Po.
Die schattige Waldpassage lag weit hinter mir, als mich der Radweg ins freie Gelände zum Lochy Fluss lenkte. Auf dem Wasser ging es zu wie auf einer Bootsmesse, nur dass der Wert der vertäuten und fahrenden Schiffe und Boote weit unter ihrem Neuwert lag. Die Ufer säumend, lagen Bug an Heck diverse Jollen mit gerefften Segeln und Kajütenboote und Yachten mit abgeschaltetem Motor. Die Schiffe waren vertäut und ihre Kapitäne, Rudergänger und Leichtmatrosen gönnten sich ein Schwätzchen bis sie artig gestaffelt zu Neptuns Treppen vorgelassen wurden.
Dank einer deutschen Ingenieursleistung gelang es dem Schiffsverkehr über mehrere Treppen erstaunliche 42 Höhenmeter zu bewältigen, die der Caledonian Canal vom Atlantik zur Nordsee überwindet. Nicht wie unter dem Kommando eines besessenen Fitzcarraldo in einer mörderischen Hauruck-Aktion, sondern gemächlich von Kammerschleuse zu Kammerschleuse ging diese Bergfahrt der Binnenschiffe vonstatten. Neptune’s Staricase bestanden aus acht Kammern mit gigantischen Schleusentoren, die tonnenschweren Wassermassen standhalten mussten, und erlaubten regen Schiffsverkehr zwischen Loch Lochy und Loch Ness. Am Abend sollte ich einen alten Seemann treffen, der von der Nordsee kommend, Loch Ness und einen Großteil des Kanals durchfahren hatte.

Der Kaledonische Kanal ist eine kühne Ingenieursleistung des frühen Maschinenzeitalters, die heute vor allem dem Tourismus dient. Anders als der Union Canal zwischen Edinburgh und Glasgow, wo man in eine verwunschene Wasserwelt voller Tümpel, Seeroseninseln und Schilfgestrüpp eintaucht und gelegentlich von den tiefhängenden Ästen der Trauerweiden gestreichelt und in dunklen Tunneln beregnet wird, ist er ein kilometerlanger lärmender Campingplatz. Eine Aneinanderreihung von Kiosken, verwitterten Wohnwagen und Hunderten von ankernden Hausbooten, von denen viele vergessen im Wasser verrotten und den Kanalufern an seichten Stellen den Anschein eines Friedhofs geben.
Gegen Nachmittag hatte ich mich weitgehend aus den Zwängen meines Muskelkaters befreit und freute mich auf die letzte Wegstrecke. Am Golfplatz verkündete ein königsblaues Schild, dass Loch Ness gleich erreicht sei. Als ich das Clubhaus passierte, sah ich auch schon den Portikus, zumindest bildete ich mir ein, durch ein Tor in die einstige Römersiedlung Fort Augustus hineinzuradeln. Tatsächlich war es kein Tor, sondern die Stangen einer Höhenbegrenzung an der Einfahrt zum bewachten Busparkplatz.
Kohorten von Tagestouristen, bewaffnet mit der Absicht, ein Schnäppchen an einem Nessie-Souvenirstand zu ergattern, streiften durch die Gassen des 600-Seelen-Dorfs. Zu Fuß, das Rad schiebend, schlängelte ich mich zwischen Männern und Frauen und Kindern in schlabberigen Jogginghosen und gesteppten Thermojacken, aber auch zwischen Teenagern in Flip Flops und T-Shirts hindurch, um auf den Dorfplatz am Schleusenhafen zu gelangen. Dank meiner Wendigkeit war ich all den Bussen, Pickups, LKWs und PKWs, die sich in der Ortsmitte verkeilt hatten, überlegen. Während sich die Fahrer der Blechkarossen Wortgefechte am Brückenkopf lieferten, um auf den Parkplatz oder weiter zu kommen, stellte ich mein schlankes Gefährt relaxed am Fahrradständer von The Lock Inn ab und ließ mich an einem Holztisch nahe dem Schleusentor nieder. Im Freien gönnte ich mir das reichlich verdiente Feierabendbier. Der Schuss Elektrolyte mit etwas Glukose gaben mir den kleinen Kick, um mit Eifer die Quartiersuche anzugehen. Viel brauchte ich diesmal nicht zu unternehmen, denn beim Bier war ich mit meinem Gegenüber, einem ortsansässigen Polen, ins Gespräch gekommen. Hilfsbereit organisierte er mir per Handy eine Übernachtungsmöglichkeit.
Abseits vom Touristengeschnatter fand ich ein Mansardenzimmer, das mich traumhaft ruhig empfing. Noch in Kleidern warf ich mich aufs Bett, um die Stille zu genießen – bis zu dem Moment, als es im Garten plötzlich scheppernd dröhnte, als hätte jemand in eine Kindertröte gepustet. Erschrocken sprang ich hoch und sah aus dem Dachlukenfenster. Im Garten erspähte ich ein Paar fetter Fasane, die immer wieder dieses metallische Tröten ausstießen, während sie umher stolzierten. Sie staksten durch ihr Revier, pickten den einen oder anderen Wurm aus dem englischen Rasen und hatten anscheinend ein diebisches Vergnügen an ihrer Kakophonie. Erwürgen hätte ich diese Quälgeister können, aber vor lauter Hunger ergriff ich dann doch lieber die Flucht und lief zurück zur Dorfwirtschaft. The Lock Inn hätte gut in jeden Nordsee-Hafen gepasst, aber es gab diesen Treff der Land- und Wasserratten nur in Fort Augustus an der Schleuse.
Das Lokal im Viktoria-Stil mit viel Mahagoni-Imitat und mattglänzenden Messingbeschlägen an Tresen, Türen und Fenstern war immer noch von Touristengruppen belagert, selbst draußen neben dem Kanal, wo zur Blauen Stunde nicht mehr als 8 Grad Lufttemperatur herrschten. Drinnen allemal! Am mächtigen Schanktisch standen die Gäste in Dreierreihen. Die zu spät gekommenen Trinker mussten an den Fronttrinkern vorbeigreifen, um an ihr abgestelltes Glas Ale oder blondes Belhaven zu kommen. Sehr selten griff einer aus der hinteren Reihe nach seinem abgestellten Dram – der Schluck Whisky ist im Pub einfach zu teuer.
Wirtsrufe wie „Sofort bezahlen!“ und „Essen nur an den Tischen!“ übertönten den brodelnden Lärm im überfüllten Lokal, wo in einer Nische auch noch zu einer Mundharmonika gesungen wurde.

Die Beine wollte ich mir nicht in den Bauch stehen, immerhin hatten sie trotz Muskelschmerz beachtlich gekurbelt und ein Tagespensum von 62 Kilometern geschafft. Da es an allen Tischen eng zuging, blieb mir nichts anderes übrig, als mich in eine Ecke zu quetschen, wo drei Schotten die Köpfe zusammensteckten. Wie sie redeten, fielen aus ihren Sätzen ab und an verständliche englische Begriffe wie Brosamen für mich ab, ansonsten aber rollten sie lange Sätze wie leere Whiskyfässer und die „Ooohs“ und „Schiis“ hätten sie nicht gedehnter aussprechen können.
Irgendwann mischte ich mich in ihre Unterhaltung ein und meinte, sie seien wohl Highlander. Kurz stockte der Wortwechsel, dann lachten sie im Chor und bestätigten mir nickend ihre Herkunft, die ich wohl aufgrund ihres weichen Zungenschlags erraten hätte. Der Schotte mit dem weißen Wuschelhaar, das wie struppige Schafswolle unter seiner Kapitänsmütze hervorquoll, erging sich aus Spaß in Oxford English: „Wortschnipsel wie yes or no, so was Kurzangebundenes gibt es im Gälischen nicht. Unsere gälische Zunge geht viel einfühlsamer mit den Worten um, weil wir die Reime so lieben.“ Er kratzte sich hinter dem Ohr und überlegte kurz, dann ergänzte er ernst: „Wir Schotten lieben seit altersher den Gesang, jede Art von Melodie, das genau beweisen die vielen Reime, die dem Englischen fehlen.“
Während ich auf meine Bestellung, einen Süßkartoffel-Kichererbsen-Mais-Eintopf, wartete, entspann sich ein Gespräch zwischen dem deutschen Whiskyradler, einem jungen Ingenieur für Windenergie, einem pensionierten Kapitän und dessen Kumpel, mit dem er auf einem Segelboot von der Nordsee zum Atlantik unterwegs war. Diese Unterhaltung entfaltete sich weitaus profunder als man es von deutschen Stammtischen gewohnt ist.
Der pensionierte Kapitän war der Wortführer, aber nicht wegen seines bestimmenden Tenors, sondern weil er eine ganze Menge auf dem Kasten hatte. Nach unserem ersten Beschnuppern, woher und wohin und natürlich warum und weshalb, machte er mich mit dem schottischen Nationaldichter Robbie Burns bekannt. Diese Bildungsoffensive kam nicht zufällig aus heiterem Himmel. Auf den berühmten Dichter kamen wir über den Whisky, den Robbie Burns über alles liebte und von dem er einmal gesagt haben soll: „Whiskytrinken ist wie das Betrachten eines Gemäldes. Jeder sieht in dem Bild etwas anderes, was ihm gefällt.“
Burns, das las ich dann später nach, war nur 37 Jahre alt geworden, er starb anno 1796 nach einem recht stürmischen und rastlosen Leben. Bevor er zu dichten anfing, hatte er sich als Steuereintreiber verdingt, der illegale Schwarzbrennereien aufspüren musste. Als Staatsbeamter war er zwar bewaffnet, doch gerne drückte er ein Auge zu und zog wohl nie den Revolver, um einen Schwarzbrenner zu arrestieren oder gar zu erschießen. Überliefert ist ein kleines Gedicht, das heute noch jeder Whiskykenner frei rezitieren können muss. Es handelt von John Barleycorn und sinngemäß wird darin die förderliche Kraft des Whiskys beschrieben: „Wer das Blut jenes Johann Gerstenkorn trinkt, dessen Mut wächst Schluck für Schluck“.
(Fortsetzung folgt)