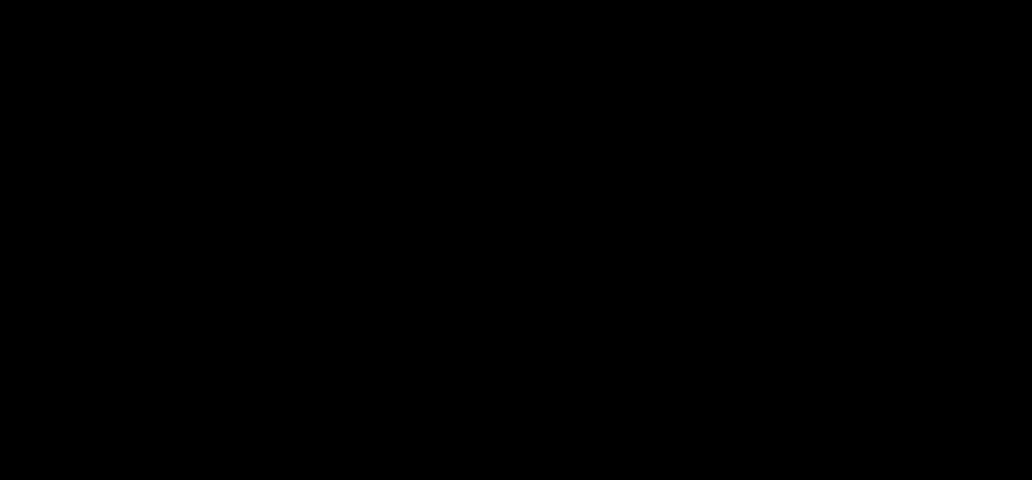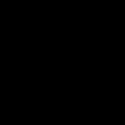Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 47)
Im Visitors Center wurde uns von einer dunklen Thailänderin der fünfzehnjährige Single Malt von Glen Garioch als Dram auf der runden Metallplatte eines Stehtischs serviert. Rechts und links und überall von der üblichen Palette an einfallslosen Vermarktungsartikeln bedrängt, kam ich mir inzwischen auch schon als eine Art Werbeonkel vor.
Während Alistair durch das Adressverzeichnis seines Handys scrollte, wanderten meine Gedanken zurück zur leeren VAT-Flasche mit dem Tequila-Hütchen aus rotem Plastik. Wie traurig und verlassen das Maskottchen einer Berühmtheit von einst doch auf dem Eckregal gestanden hatte! Vermutlich schon lange, so eingestaubt wie die dunkelgrüne Flasche war. An der ironischen Hütchen-Maskarade war abzulesen: vorüber, die glorreichen Zeiten, mit den Jahren verdrängt, vergessen, im Kabinett der Erinnerungen gelandet. Zu meiner Jugend war der VAT 69 noch ein illusterer Name gewesen, ein großer Name wie Black & White, Johnnie Walker und Dewars. Aber heute bot er nur noch Anlass zum Schmunzeln.
Nachdem Alistair in seinem Adressenspeicher fündig geworden war, sagte er: „Kontaktieren Sie Joanne McKercher in den Diageo Archiven, die kennt sich mit der Geschichte des VAT 69 gut aus. Ich kann Ihnen da leider nicht weiterhelfen.“ Vermutlich spürte er einen Anflug von Wehmut bei mir, deshalb hob er gleich das Dram und prostete mir aufmunternd zu: „Cheers, dann probieren Sie mal unsere Nummer Eins – Glen Garioch, 15 Jahre, 53 % vol., ausschließlich im Oloroso Sherryfass gereift.“
Als ich das bauchige Nosing Glas mit der Gravur 1797 gegen das einfallende Sonnenlicht hielt, strahlte das Schlücklein wie leichter Tokajer. Trotz der hellen Farbe wälzte es sich beim Kreiseln im Glas erstaunlich ölig. An Sesamöl musste ich denken. Die schwere Dichte gefiel dem Auge und sofort verlangte es mich nach einer Schnupperprobe.
In die Nase strömten Aromen von buttrigen Bisquits, Honig und Zimt. An der Zungenspitze meldeten sich nicht Früchtchen, sondern langgereifte Früchte von Ananas, Rosinen und Feigen, allesamt süß und nochmals süß – für mich zu süß. Plötzlich dann der Umschwung: gleich einem Kuckucksei entdeckte ich mittendrin eine medizinische Note, so ein Nelkengeschmack wie man ihn vom Zahnarzt kennt. Abgesehen von dem Quentchen Bitterkeit, gestaltete sich der Nachklang wieder klebrig süß. In der Tiefe des Gaumens verwandelte sich schlagartig die Wärme des Alkohols in ein Brennen und böses Kratzen. Zuviel Holz domininierte den Abgang und ließ einen plumpen Eindruck zurück. Insgesamt war die Süße ein gefälliges Potpourri, aber der Früchtekorb war nicht raffiniert genug geschichtet. Die übertrieben süffige Note brachte Einseitigkeit in die Textur, die ich auf den ausschließlichen Ausbau im Sherryfass zurückführte. Komplex bewertet, enttäuschte der Single Malt meine Erwartungen, deshalb erhielt er nur zwei Stützräder.
Nach der Verkostung redeten wir noch kurz über das umständliche Hin und Her im Arbeitsablauf zwischen den einzelnen Stationen hier und in Glasgow. „Digger“ Grant murmelte etwas von Hektik und fehlender Ruhe. Sein Vorgesetzter sagte nichts, ihn drängte es schon wieder zum Aufbruch, er müsse heute noch zurück nach Glasgow. So verabschiedeten wir uns vor seinem Dienstwagen auf dem Hof. Alistair nahm noch mein Rad unter die Lupe und fragte mich nach meinem nächsten Ziel.
„Morgen Aberdeen, dann Dundee und weiter nach Edinburgh.“
„Brave German! Also alles Gute, kontaktieren Sie auf jeden Fall noch Joanne in den Diageo Archiven, sie kann Ihnen gewiss weiterhelfen.“ Mit diesen Worten überreichte er mir seine Visitenkarte und ich revanchierte mich mit meiner, die neben seiner recht bescheiden aussah.
Tage später sollte ich eine Email aus den Diageo Archiven erhalten, die das VAT 69-Puzzle um entscheidende Elemente ergänzte und mein Wissen komplettierte.
William Sanderson, der VAT 69-Erfinder, eröffnete im Jahr 1863 im Edinburgher Vorort Leith einen Laden, wo er französische Weine, Cognac, Sherry und Portwein verkaufte – und heimische Whiskys. Aber diese waren nur ein Nischenprodukt, denn die Kunden von damals verlangten nach Spirituosen vom Kontinent, insbesondere liebten sie französischen Cognac. Zur damaligen Zeit war solch ein Getränkeladen nichts anderes als ein düsterer Lagerraum mit vielen Fässern und Fässlein am Boden und auf grobgezimmerten Regalen. Die Laufkundschaft brachte ihre eigenen Gefäße zum Befüllen mit, meistens Tonkrüge oder Krüge aus Steinzeug, beliebt waren auch ausgetrunkene französische Weinflaschen, die aus dunkelbraunem oder dunkelgrünem Glas handgeblasen waren. Als Schotte wollte Kaufmann Sanderson erreichen, dass seine Stammkunden mehr heimischen Whisky konsumierten, so kam er auf eine für die damalige Zeit verwegene Idee: er mischte Whiskys unterschiedlicher Reifungsgrade und Geschmacksrichtungen. Mehr noch! Er ging sogar soweit, dass er schottische Malts mit amerikanischen Grains vermählte. Mit diesem Schritt folgte er seinem Geschäftsfreund Andrew Usher II, der als Urvater des Blendings gilt.
Archivaufzeichnungen belegen, dass William Sanderson ein geselliger Mensch war. Bevor er seine Blends im Laden verkaufte, lud er Freunde und Kunden immer wieder zu Blindverkostungen ein. Zu diesem Anlass stellte er hölzerne Bottiche, vats, nebeneinander auf und nummerierte jeden vat mit einer Zahl, die er mit Kreide auf die Holzwand schrieb. Als er wieder einmal zur Blindverkostung einlud, entschieden sich alle Gäste einstimmig für den Blend aus dem Bottich 69 als mit Abstand besten Blend. Der VAT 69 war geboren und wurde ab 1882 zum erfolgreichsten Whisky der Welt.
Erst nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1908 lüftete sein Sohn William, der ebenfalls nie eine eigene Brennerei besaß, die Rezeptur des Bottichs Nummer 69, und die Welt erfuhr, dass 40 Malts und Grains, alle in der Glen Garioch Destillerie gebrannt, vermählt worden waren.
Vater und Sohn Sanderson, Andrew Usher II, Richard Paterson, Billy Walker und alle Master Blender der Welt würden sich die Haare raufen, definierte man das Verfahren des Blending als Cocktailisieren oder bloßes Mixen von Spirituosen. Blenden ist ein stilistisches Komponieren nach Prinzipien von leicht, medium und schwer, um einen ausgewogenen Körper zu erschaffen. Hierfür wird ein nach Gras duftender und nach Karamell schmeckender Getreidewhiskey, der aus Weizen, Mais und Roggen gebrannt sein kann, als Gast eingeladen, um die Aufgeregtheit, die Würze und das Klobige eines getorften Malts zu verfeinern. Stets entwickelt sich das Wechseln der Fasslagen, das Trennen und Zusammenführen unterschiedlicher Komponenten wie der Bau eines Gebäudes – in Etappen. Gereifte Destillate aus Getreide und aus Malz verschiedener Jahrgänge und Sorten werden in einem Bottich vermengt und anschließend als Verschnitt in ein einziges Fass oder in mehrere Fässer gegeben. Und zwar in Fässer, die zuvor anders belegt waren.
Neu komponiert, reifen sie nun als homogenes Ganzes über einen Zeitraum von ein, zwei oder drei Monaten und finden schließlich in Ruhe zueinander. Nun ist über der Zeit ein neuer Geschmackskörper gewachsen und am Ende eines gelungenen Blendings kann sein Schöpfer stolz auf das geschliffene Wesen seines Blends sein, dem die Zacken und das Ungestüme eines Single Casks fehlen.
* * *
Über einen Monat war ich nun auch schon „gereift“ und hatte die Hörner des Drängens abgeworfen. Die 30 Kilometer bis in die Hafenstadt Aberdeen ging ich mit dem Gleichmut des Geübten an und wählte eine abgelegene, überaus ruhige Nebenstraße. Via Newmachar pirschte ich mich an die große Stadt an der Küste heran. Da ich nach 25 Kilometern aus der Ruhe kam, bekam ich auf der restlichen Strecke ins Zentrum Ohrensausen. Ja, kaum, dass die Stadtfahrt begann, hieß es Ohren zu und durch.
Motorenlärm vom Boden und aus der Luft lag über dem Aberdeen Heli-Port, wo getaktet Hubschrauber von und zu den Ölplattformen in der Nordsee flogen. Mit erhöhtem Pulsschlag brachte ich diese Hölle hinter mich und stoppte erschöpft an einem Kaffeebüdchen, um nicht mit leerem Magen in den Bannkreis einer nervzehrenden Urbanität einzudringen.
Die Nervosität, die mich immer in der Weichzone einer großen Stadt befiel, flammte jetzt wieder auf, zum Glück aber nur kurz, denn ein gut ausgeschilderter Radweg schlängelte sich am buschigen Ufer des Don bis tief ins Zentrum hinein. Über dem Schauen auf Wohnhäuser und Industriebauten spulte ich die letzten Kilometer ab und kaum, dass ich mich versah, stand ich auf der Stadttangente, die Schottlands drittgrößte Stadt wie einen Brotlaib in zwei Hälften zerschneidet. Hier war ich von Beton, Asphalt und sich langsam vorwärtsschiebenden Autos umzingelt und ernsthaft fragte ich mich: bist du in einer rad- oder autogerechten Großstadt angekommen?
Über dem Schauen nach rechts und links hatte ich zwar die gesprühte Kampfparole „Go Yoga, go vegan“ an der Bretterwand einer Baustelle entdeckt, mich aber verfahren. Entweder hatte ich an einer Ampel den Hinweis zum Union Square übersehen oder ich war vor lauter Aufregung statt über eine Brücke geradeaus gefahren. Jetzt blieb mir nichts anders übrig, als auf einem schmalen Asphaltstreifen neben dem Feierabendstau herzufahren und reduziert zu atmen. Glück gehabt! Da vorne kam wieder eine Brücke über die tiefergelegte Tangente in Sicht und ich fand einen Fluchtweg, markiert durch ein königsblaues Schild, das mich in ruhigere Straßen lenkte.
Um zu verschnaufen, auch um das Wesen der Granitstadt zu erspüren, hielt ich am Bordstein an – ohne abzusteigen. Mit den Turnschuhsohlen auf dem Kopfsteinpflaster abgestützt, konnte ich mich um die eigene Achse drehen und mir einen ersten Rundblick über die Altstadt erlauben. Hinter einem kleinen Park entdeckte ich etwas Befremdendes: Seite an Seite, keine fünf Meter voneinander entfernt, wuchs ein verglaster Betonspargel neben einem spätgotischen Kirchturm in den Himmel. Kannte die Granitstadt keinen Denkmalschutz und keinen Respekt vor sakralen Bauten? Oder waren auch hier wie in Edinburgh und Inverness viele der Kirchen keine Kirchen mehr, sondern Kneipen und Cafés für Presbyterianer wie für Moslems, Juden, Hindus, Buddhisten und Atheisten gleichermaßen?
Als ich gemächlich weiterfuhr, stieß ich auf einen Boulevard, wo unmittelbar vor der Ampel großflächig ein Feld mit dem Piktogramm eines Radfahrers auf den grauschwarzen Boden gemalt war. Zeigte die Ampel rot, war das Radfeld autofrei und tatsächlich nur von Radfahrern besetzt. Mich erstaunte, wie diszipliniert sich die wartenden Autofahrer an diese Regelung hielten und nur bis an das maisgelb umrandete Feld heranfuhren und in zweiter Reihe stoppten. Selbst als sich der Verkehr zweispurig auf hundert Meter staute, kam kein Autofahrer auf die Idee, die freie Busspur, die außer den Bussen nur Radfahrer benutzen durften, zu befahren, um sich am Stau vorbeizumogeln. Da diese Regelung an allen großen Straßenkreuzungen galt, machte das Durchfahren der Granitstadt richtig Spaß. Immer wieder radelte ich forsch an einer Autoschlange links vorbei und besetzte auf dem autofreien Radfeld die Pole-Position, eine Position mit vielen motorisierten Followern im Rücken. Als die Ampel von Rot auf Grün wechselte, musste sich der anfahrende Autoverkehr an meinem Tempo orientieren, erst als ich auf die seitliche Busspur einschwenkte, durfte er mich überholen. Famos, dachte ich und wünschte mir dieses Privileg auch in deutschen Städten.
Das Zentrum querte ich entspannt, meistens die Bustrasse befahrend, und erreichte Murray Terrace im Süden, wo ich am Duthie Park das empfohlene Hotel fand. Die ruhige Gegend um meine Unterkunft lebte von zweistöckigen Stadthäusern mit runden Erkern und schaufenstergroßen Wohnzimmerfenstern, deren Granitfassade hinter wildem Wein und Efeu kaum auszumachen war. Oft hatten die Hausbewohner die Auffahrten mit immergrünen Büschen von Rhododendron und Kirschlorbeer bepflanzt, und den Portikus der Häuser säumten violette und weiße Hortensien. Typisch für das Wohngebiet waren aber auch kurze Auffahrten mit gekiesten Stellflächen für die zwei, drei Familienkutschen.
Am nächsten Tag vertrödelte ich die Stunden. Locker in den Waden, erkundigte ich die Straßen der Granitstadt und ganz ohne Absicht landete ich im „Old Aberdeen Bookshop“, einem Antiquariat in Spital, wo ich ein rares Whiskybuch im Bücherallerlei fand und für einige Pfund kaufte. So vergingen die Ruhestunden recht schnell. Die Schlenderfahrt kreuz und quer durch die City zeitigte die Erkenntnis, dass Aberdeen eine „No-problem-Stadt“ ist. Anstatt „ja“ oder „okay“ oder gar „that’s brilliant“ zu sagen, hörte man aus dem Mund der Aberdeener bei jeder Gelegenheit: „no problem“. Selbst in einem winzigen Plumcake Shop, wo eine Schülerin selbstgebackene Kuchen zu keltischer Fidelmusik verkaufte, begegnete mir dieser Spruch, als mir das Selbstgebackene angeboten wurde. Gerne empfing ich das süße Küchlein, das mir lächelnd angeboten wurde. Warum immer nur Drams, warum nicht mal einen Pflaumenkuchen probieren? Leider schmeckte das Kuchenstückchen für meinen Geschmack viel zu süß. Also bedankte ich mich ohne etwas zu kaufen, worauf die blutjunge Verkäuferin nur mit „no problem“ antwortete und mich lächelnd entließ.
Als sich zur Mittagszeit mein Magen meldete, steuerte ich in der Hafengegend das Gasthaus Crees Pub, estab. 1848 an. Der Wirt vom Pub stand draußen vor der Tür. Vermutlich war er Wirt und Koch zugleich, denn um die Hüfte trug er eine lange weiße Schürze. Alles sah einladend aus, das Haus, der Mann und die Blumen vor der Tür. Hier wollte ich pausieren und zu Mittag essen.
(Fortsetzung folgt)