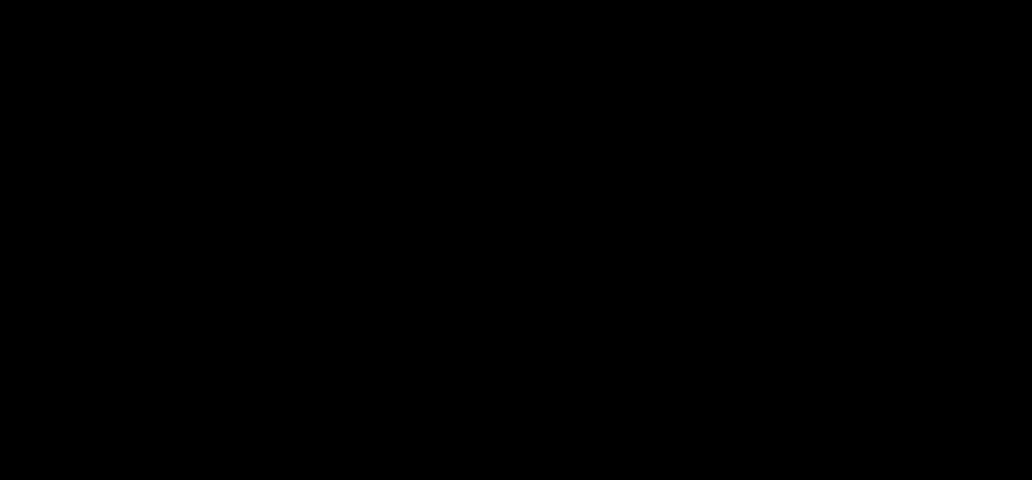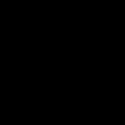Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv im Vorabdruck präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist am 01.02.2021 im Alba Collection Verlag GbR erschienen. Es kann zum Preis von 19,- Euro hier vorbestellt werden.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 10)
Am Straßenrand stand auf einer Uferwiese eine Ruhebank wie in einem offenen Garten. An ihr stoppte ich das Rad und schaute auf die Uhr. Alle Achtung, überraschend flott hatte ich mein Tagesziel erreicht. Einen Schluck Wasser, die Beine vertreten – das tat ich nun, um zur Ruhe zu kommen. Viel Adrenalin flutete noch immer den Körper, aber ich bändigte mich. In Urlaubsmanier setzte ich mich auf der breiten Bank nieder, trank aus der Wasserflasche und vesperte die Toasts von Mrs. Lorry.
Wie ich auf die glitzernde Indaal Bucht vor meinen Füßen blickte, kamen mir plötzlich umweltrelevante Gedanken: was wird aus der Destillerie in meinem Rücken, was aus den Destillerien von Laphroaig, Lagavulin, Bowmore und Ardbeg und all den Menschensiedlungen entlang des Inselsaums werden, wenn der Meerespiegel durch das Abschmelzen der Polkappen steigt? All diese Gebäude waren Gebäude des Trotzens gegen die Wassergewalten, solide Zufluchten, gebaut gegen Orkane und Sturmfluten. Aber sie waren auch zweckmäßig am Ufer positioniert, weshalb ihre altgefügten Fundamente nur knapp den Wasserspiegel überragten. Müssten sie in Zukunft umgesiedelt oder mit neugeschaffenen Dämmen geschützt werden? Eine Besorgnis erregende Frage, die von Wirtschaft und Politik noch immer ignoriert wird.
Da das geschmiedete Tor zwischen den beiden kasernenartigen Gebäuden offen stand, konnte ich mein Rad auf den Innenhof schieben und es neben dem Eingang des Visitors Center parken. Hier hatte die Geschäftsleitung sogar einen kleinen, überdachten Radplatz eingerichtet, wie ich voll Freude feststellte. Das Rad, den Helm und die Gepäcktaschen schloss ich mit dem Kabelschloss an einem Poller fest und trat in meiner schwarzen Radmontur in einen schummrigen, langgestreckten Saal, der früher den Darr- oder Mälzboden bildete. Die Gusseisensäulen, welche die Balkendecke trugen, hatte man als Relikt stehen lassen und nur glänzend lackiert. Noch bevor ich an die lange Holztheke des Ausschanks trat, streifte mein Blick ein dunkel gebeiztes Wandregal an der Stirnseite des Saals. Schau an! Vom Regal grüsste der raffinierteste Werbegag der gesamten, weltumspannenden Whiskybranche – der schrill türkise Classic Laddie. Mir schauderte, wie ich dieses knatschige Türkis in vielfacher Ausfertigung im Display auf der Mittelkonsole erblickte. Ganz und gar unpassend empfand ich dieses Knallbonbon für ein seriöses Trinkprodukt, das den Classic Laddie wie den Flakon eines billigen Parfums aussehen ließ.
Nachdem ich das Regalsortiment mit den aktuellen Malts aus der Nähe betrachtet hatte, gesellte ich mich zu den frühen Gästen am hohen Verkostungstresen. Irgendwie war ich gereizt, etwas in mir rumorte, vielleicht war der Wechsel aus der frischen Luft in einen stickigen, nach Synthetik und Whisky riechenden Raum zu abrupt gewesen. Noch bevor ich mich für ein Dram Bruichladdich entscheiden konnte, fragte ich eine der freien Servierdamen provokant, ob diese türkise Flasche auf der Theke ein Werbegag von Rémy Cointreau sei?

„Oh nein, diese Farbgebung ist keine französische Erfindung unseres Eigentümers, nein, nein!“, wehrte die adrette Dame in der schwarzen Bluse ab und schüttelte energisch den Lockenkopf, als hätte ich ihr einen unsittlichen Antrag unterbreitet. „Das Türkis ist eine Erfindung des früheren Besitzers Murray McDavid. Ich arbeite noch nicht so lange hier, aber mir wurde bei der Einstellung folgende Story erzählt: An einem sonnigen Tag wie heute soll Mister McDavid, der gerade die Brennerei von Jim Beam Brands gekauft hatte, an einem dieser Saalfenster gestanden und auf Loch Indaal hinausgeschaut haben. Vor seinen Augen musste das Wasser so grünlich-blau gefunkelt haben, dass er die Eingebung der Farbe Türkis bekam. Und daraus entstand dann im Jahr 2000 die provokante Idee, mit einer türkisen Flasche ein neues Sortiment zu starten. Seither erkennt die ganze Welt einen Bruichladdich an dieser einmaligen Farbe“, sagte die adrette Dame und ich spürte ihre Genugtuung für ihren Arbeitgeber.
Entweder war es ihre sachliche Erklärung oder das Timbre ihrer weichen Stimme, die mich mit der schrillen Farbe versöhnten. Und ich hörte mich kleinlaut sagen: „Schon beinahe spirituell, auf jeden Fall werbetechnisch brillant!“
Nach ihrem redlichen Bemühen bat ich sie um eine Kostprobe. Nein, nicht den türkisen Classic Laddie, sondern den berühmten Octomore wollte ich probieren.
„Eine gute Wahl“, sagte die Dame in der schwarzen Bluse und schenkte mir einen Probierschluck aus einer pechschwarzen Flasche ein. „Our most peated malt, cask strength, 58 % vol.“
Sanft wie ein Lamm bat ich sie, mir bitte auch die Flasche zu reichen, ich wolle die Aufschrift gerne lesen. Auf dem Etikett des Octomore stand kleingedruckt 80 ppm, was für Insider ein Hinweis auf die Stärke der Torfnote ist und einer Erklärung bedarf.
Das international geltende Kürzel ppm bedeutet „phenolic parts per million“ und beinhaltet wie der Name schon sagt, eine überaus subtile Maßeinheit des Phenolgehalts, der mit einem Hochleistungsflüssigkeitschromatographen gemessen wird, den Chemiker HPLC nennen. Für die Messung wird in einer Säule, dem Herzstück des Apparats, ein Lösungsmittelgemisch in seine chemischen Bestandteile zerlegt und analysiert: Wieviele Phenole in der gemälzten Gerste stecken bzw. sich auf ihr abgelagert haben, also jene Bestandteile, die für einen bitteren, teerigen, ledrigen, rauchigen, aber auch vanilligen und zimtigen Geschmack sorgen. Die Zahl 80 ppm auf dem Etikett bewies, dass die über dem Torffeuer gedarrte Gerste zu Beginn ihrer Verarbeitung einen sehr hohen ppm-Gehalt von 160-200 hatte, der durch die Fermentation und Destillation, vor allem aber durch die Fasslagerung mit den Jahren geringer wurde und nun im gereiften Whisky nur noch zur Hälfte vorhanden ist. Mit den Phenolen verhält es sich wie mit der Gerbsäure im Rotwein. Mit den Jahren im Eichenfass werden sie abgebaut und der Whisky wird weicher am Gaumen, was jeder Kenner bestätigen kann.
Der Saal unter der bedrückend niedrigen Holzdecke hatte sich inzwischen mit zahlreichen Besuchern gefüllt und es ging zu wie an einer Theatergarderobe kurz vor dem ersten Klingeln. Von allen Seiten bedrängt, regelrecht umzingelt, wurden die Rundständer und Tischauslagen mit schwarzen T-Shirts, Jacken, Kappen, Handtüchern, Handseifen und Lotionen mit dem Bruichladdich-Logo. Da ich den Auftrieb bereits kannte, hatte ich mich abseits in einem schwarzen Kunstledersessel verschanzt, vor mir das schwach gefüllte Nosing Glas auf einem Glastisch.
Während ich dem Torfhammer noch Zeit zum Atmen ließ, studierte ich einen ausgelegten Flyer mit der Werbung des Erzeugers, auf dem stand „der Welt stärkst getorfter Whisky“. Wie ich so die Erläuterung las, fiel mir der „Sweet Spot“ ein, ein medizinischer Begriff für das plötzliche Umkippen von Euphorie in Ekel beim übermäßigen Genuss von Alkohol und plötzlich beäugte ich das bauchige kleine Glas Octomore, das sich vor meinem geistigen Auge in eine Arznei mit der Aufschrift „Achtung 80“ verwandelte. Wirklich, Ekel stieg in mir hoch und ich wünschte mir nichts sehnlicher als den Sweet Spot – allerdings in umgekehrter Reihenfolge.
Nichts da! Kein Kneifen, ich musste mich jetzt zwingen und all meine Sinne auf den Torfwhisky konzentrieren. Wieder wandte ich mein erprobtes Schema an: Nase rechts, Nase links, Gaumengrund beträufeln, kauen, einspeicheln, schlucken, schmatzend nachschmecken.
Kauen von Flüssigem klingt unsinnig, ist es aber nicht, denn durch die Kieferbewegung gelangen die Aromen auf verschiedenen Bahnen zum Riechzentrum im Nasendach: sowohl durch die Mundhöhle als auch durch die Nasengänge. Und riechen könnte nicht wichtiger sein, denn der Mensch riecht tausendfach besser als er zu schmecken vermag.

Wie zu erwarten, wehte mich bei der ersten Annäherung etwas an, das mich nicht gerade an einen karibischen Sonnenuntergang erinnerte. Voll Abscheu registrierte die Nase Asche, Terpentin, hartgekochte Eier und geräucherten Speck. All diese widrigen Duftnoten stiegen mir in das rechte Nasenloch. Wie ich das Glas ans linke Nasenloch führte, kam es noch schlimmer, mir stieg ein süßlicher Verwesungsgeruch ins Nasendach, auf den butterige Aromen folgten. Puh! Eklig, diese Ausdünstungen! Ich musste würgen. Sollte ich mein erzwungenes Vorhaben abbrechen? Keinesfalls, es musste sein, ich musste meine Ressentiments gegen einen Torfhammer endlich überwinden. Ich zwang mich und träufelte ein Schlückchen unter die Zunge und kaute. Der Speichelfluss setzte augenblicklich ein. Das anfängliche Brennen von 58 % vol. Alkohol ließ langsam nach, das lodernde Gaumenfeuer fiel in sich zusammen.
Plötzlich geschah etwas, das mich staunend schlucken ließ – eine verblüffende Süße breitete sich auf der Zungenplatte aus. Ein echtes Geschenk! Ich erlaubte dem Octomore, mich ein zweites Mal zu überraschen. Das gelang ihm glatt und gradliniger als beim ersten Schluck. Eine fruchtige Süße verdrängte erstaunlich rasch das Bittere, Rauchige und Speckige. Beim Abgang ereignete sich noch etwas Verblüffendes. Just in dem Moment, als der eingespeichelte Schluck die Speiseröhre passierte und sich eine schöne Wärme breitmachte, meldeten sich Nachzügler – salziger Torfrauch und fruchtige Süße, die als Gegenspieler den Octomore 2000 charakterisierten. Ich naschte die restlichen Tropfen aus dem Glas, spülte den Gaumen mit einem Schlückchen Karaffenwasser und resümierte: Für jemanden mit der Präferenz für getorfte Whiskys ist der Octomore ein Gedicht. Für mich als einen eher Süßen erzielte er auf meiner Radler-Skala immerhin drei Stützräder.
Mittlerweile war das Shopping Areal des stickigen Saals voll von schnatternden Besuchern aus aller Welt und an meinem Tisch drängten sich Whiskytouristen aus Indien, Männer mit dunklen Gesichtern und kräftigen Nasen. Ihre Frauen trugen goldene Nasenstecker, protzige Goldreifen und gewaltige Ringe an den Armen und Fingern. Das Übermaß an Leibesfülle verbargen sie unter bunten zeltförmigen Gewändern. Die Gäste aus dem fernen Indien hatten sich grußlos zu mir an den Glastisch gesetzt und plappern und schwatzten als wären sie Maharadschas und Maharanis. Bei all dem Auftrieb wurde es nun höchste Eisenbahn, dass sich der Asphaltcowboy wieder in die Stille verdrückte.

Fluchtartig verschwinden oder noch einen raren Bruichladdich probieren? Mir war klar, dass ich an diesen Ort nicht so schnell wieder kommen würde. Also nutzte ich die Gelegenheit und ging zum Verkostungstresen, um mir einen zweiten getorften Malt auszusuchen, einen Port Charlotte mit einer raffinierten Eigenschaft: Der Malt von 2007 war von Rémy Cointreau in hauseigenen Cognac-Fässern ausgebaut worden. Mit einem schwach gefüllten Nosing Glas kehrte ich zu den indischen Tischnachbarn zurück.
Sowohl in der Nase, als auch am Gaumen befremdete er im ersten Augenblick durch den Gegensatz von rauchigem Torf und pappiger Traubensüße, in der auch noch Spuren von Karamell ihre Zuckernote hinterließen. Der Kontrast zwischen bitter und süß mochte ruppig sein, aber als unangenehm empfand ihn mein Gaumen nicht, eher als Überraschungsangriff mit Gefälligkeitspotenzial. Leider hielt die Gefälligkeit nicht lange an, schon erlebte der Schlund einen Schock! Mit einem Faustschlag setzte der Abgang ein, er war kurz und bitter und endete in einem nur langsam verglimmenden Feuer am Magengrund. Einen kurzen, gar flammenden Abgang mag ich ganz und gar nicht, deshalb brachte es der Port Charlotte der Brennerei Bruichladdich, die turbulente Zeiten von drohendem Bankrott und Stilllegung hinter sich hatte, und jetzt unter den Fittichen von Rémy zur Ruhe gekommen war, nur auf zwei Stützräder meiner Skala.
Große Aufmerksamkeit hatte ich der Verkostung gewidmet, aber nicht all meine Sinne. Während des Tastings lauschte ich zu den indischen Tischnachbarn hinüber und Fragmente ihrer Unterhaltung drangen an mein Ohr. Als ich auf Englisch hörte: „Kilchoman[1] war echt beeindruckend“, war ich wie elektrisiert.
„Ja, das fand ich auch. Kilchoman gefiel mir besser als Bruichladdich. Das Café war sehr schön eingerichtet und die Bedienung sehr zuvorkommend. Wie die uns eingeschenkt hat, das war wirklich großzügig.“
„Dort war es auch gemütlicher als hier.“
„Ist halt auch eine Farmbrennerei. Nicht so eine Fabrik wie hier.“
In meinem Kopf begann es zu arbeiten. Sollte ich noch bei Kilchoman vorbeischauen? Warum eigentlich nicht? War ja irgendwo in der Nähe. Unschlüssig und von den beiden Drams angenehm weich in den Knien, brachte ich das Glas zur Theke zurück und bedankte mich für die freizügige, zweite Kostprobe. Einen älteren, schwarz gekleideten Barmann mit Silberhaar und Schnäuzer, der gerade Pause vom Gläsertrocknen machte, fragte ich: „Wie weit ist es bis zu Kilchoman?“
„Knapp fünf Meilen würde ich schätzen“, meinte er und blickte fragend die Barkollegin neben sich an und diese nickte bejahend. Während die beiden noch miteinander tuschelten, vermutlich über meinen deplazierten Aufzug, trat ich bereits mit dem festen Entschluss durch die Tür: bevor ich die Insel verlasse, will ich mir noch den Umweg von 16 Kilometern zumuten und die Farmdestillerie von Anthony Wills besuchen.
[1] kil-ho-man