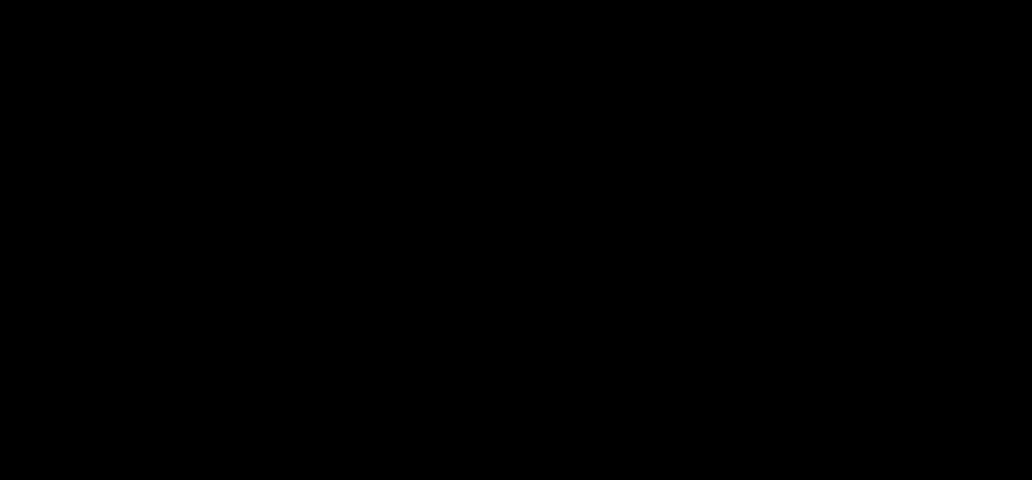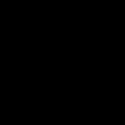Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist am 01.02.2021 im Alba Collection Verlag GbR erschienen. Es kann zum Preis von 19,- Euro hier vorbestellt werden.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 12)
Aus dem Nieselregen war ein Starkregen geworden, aus dem blitzende Regenpfeile auf mich niedergingen und mir vom aufpeitschenden Wind ins Gesicht abgeschossen wurden. Wie sie auf Wangen, Stirn und Nasenrücken aufschlugen, schmerzte es, als würde jede Hautpore akupunktiert. Verdammt, ich musste schneller werden, um ins Trockene zu kommen, womöglich gab es weiter vorne eine Unterstellmöglichkeit, redete ich mir ein, um meinen Kopf abzulenken. Aber voraus erstreckte sich nur Weideland mit stoischen Schafen, da gab es nirgendwo einen Baum mit schützender Krone, unter die ich hätte flüchten können. Gerade als ich mich noch strammer in die Pedale stemmte und dabei den Lenker ein wenig verriss, schoss von hinten ein Tanklaster an meiner rechten Seite vorbei und die Gischt, die seine mächtigen Reifen aufwirbelten, ließ mich für Momente erblinden. Als der stählerne Tank auf acht Rädern in der einsetzenden Dämmerung an mir vorbeizischte und mächtig Sprühwasser aufwirbelte, fuhr mir ein gewaltiger Schrecken in die Glieder. Wie ein Kämpfer im Lendenschurz kam ich mir vor, der sich gegen einen Gladiator im Harnisch behaupten musste. Der Fahrer, der derart verantwortungslos an mir vorbeigebrettert war und mich von oben bis unten mit Schmutzwasser bespritzt hatte, war keine Sekunde auf die Idee gekommen, dass er mit seinem Verhalten einem anderen schadete. Oh, wie ich diese Rücksichtslosigkeit, diese Unfähigkeit, sich in die Lage eines Schwächeren zu versetzen, hasste. Nicht der Regen, sondern der gepanzerte Verkehr war hier und später auch der Hauptfeind auf meiner Reise.
Nun hatte der heftige Regen auch einen Vorteil: er tränkte die Natur, dämpfte den Lärm des Verkehrs und wusch die Luft und den Asphalt unter den Reifen. Das Überholmanöver war glimpflich ausgegangen, zumindest für dieses Mal. Einige energische Pedaltritte und ich war wieder ausbalanciert und hatte mein physisches Gleichgewicht wiedergefunden. Während die roten, böse glotzenden Augen des Tanklasters kleiner und kleiner wurden, ertappte ich mich bei dem Gedanken, ihm aus der Distanz einen Hinterreifen zu zerschießen und mich an ihm zu rächen. Zum Glück trug ich keine Waffe bei mir und der Wunsch, einen Schuss auf den Truck abzufeuern, war auch schnell wieder verflogen. Es blieb bei einem herausgebrüllten Fluch, der die nahe bei der Straße weidenden Schafe aufschreckte und wegrennen ließ. Die Sprünge der bauschenden Wollknäuel auf den staksigen Stelzbeinen sahen lustig aus und ließen meine Wut augenblicklich verpuffen.
Inzwischen hatte der Wind aufgefrischt und war zum Orkan angewachsen. Böe um Böe galoppierte von der Seite auf mich zu, dass das Vorderrad zur Seite gedrückt wurde. Mit Kraft musste ich die Lenkergriffe packen und selbst in der Pause einer Flaute musste ich auf die nächste Böe gefasst sein. Zum Glück hatte ich auf Klickpedal-Schuhe verzichtet und mich für meine ausgelatschten Turnschuhe entschieden. Bei Straßen- und Wetterbedingungen wie diesen war die Sturzgefahr zu groß, denn wenn es einen schmeißt und man mit den fixierten Schuhen nicht schnell genug von den Pedalen kommt, kann man böse fallen, schnell ist die Hüfte lädiert oder ein Knie verdreht.
Als sich kurz darauf eine Steigung wie ein Bollwerk aufbaute, nahm der Regenschlag noch zu, jetzt schüttete es wie aus Kübeln. Ich bremste, ich stoppte, ich schwang das rechte Bein über das Oberrohr und gab auf. Es half nichts, ich musste das Rad schieben, zu schlapp stapfte ich durch den triefenden Regen. Wumm, zisch, zäng, brumm – schon wieder jagte ein riesiger Laster, der im Container auf seinem Aufleger vermutlich Maische-Abfälle zur Verklappung transportierte, erschreckend dicht an mir vorbei, weil er wegen des Gegenverkehrs nicht auf die andere Fahrbahn ausweichen konnte. Auf Schulterbreite schoss er an mir vorbei, nur, weil er sein ungezügeltes Tempo nicht drosseln wollte. In solchen brenzligen Situationen verteufelte ich das Radfahren auf einer Autostraße, aber das Handtuch warf ich nicht, ich kämpfte mich vorwärts, denn ich hatte ein Ziel.
Wohlgemerkt, es war nicht die physische Kraft, die mich antrieb, sondern die Erkenntnis und Erfahrung in ähnlichen Situationen, auf Klettertouren in den Alpen, auf Tibetreisen oder früheren Fernradfahrten nach Albanien und weiter. Damals wie jetzt lag der Schlüssel zum Durchhalten in der mentalen Kraft. Gewiss hatte ich nach dieser Radwoche Kondition aufgebaut, aber die Wadenkraft war unter diesen widrigen Umständen nicht von Belang, es war viel eher die geistige Stärke, die mich antrieb, weiterzumachen. In solchen brisanten Situationen flüchte ich ins Selbstgespräch, um den aufgewühlten Geist zu beruhigen. Laut sprach ich zu mir: „Los, weiter, auf jede Steigung folgt eine Abfahrt.“
In der hereinbrechenden Dämmerung veränderte sich die Landschaft kaum merklich. Die Weiden, auf denen Scharen pummeliger Knäuel im strömenden Regen ästen, wurden spärlicher und entlang der A 846 bauten sich rechts und links uralte Eichen und Eschen auf, deren gewaltiges Laubdach wie ein Baldachin die gesamte Straßenbreite überspannte. Das Asphaltband begann sich abwärts zu neigen, das spürte ich am angefachten Tempo, das ganz von alleine kam und mit jedem gerollten Meter zunahm. Nur durch sein Eigengewicht nahm das Rad Fahrt auf und wurde schneller und schneller. Sofort machte das Radeln wieder Spaß und ich vergaß das Stechen der Regenpeitsche auf der Haut. Wie das Vorderrad zischend durch das angesammelte Regenwasser pflügte und rechts und links kleine weiße Fontänen empor spritzten, kam schnell wieder Freude auf. Zwanzig Minuten später überholte ich triumphierend die Laster, die mich so rücksichtslos eingenässt hatten. An engen Serpentinen stauten sie sich einen steilen Abhang bis zum Hafenbecken hinab, wo die angelandete Fähre im Sund zwischen Islay und Jura gerade entladen wurde. Schließlich ging die Talfahrt in ein echtes Gefälle von 14 Prozent über und erforderte ein Bedienen der Lenkerbremsen bis zum Krampf in den gekrümmten Fingern. Zu guter Letzt ließ ich das Rad am Cottage-Hotel Port Askaig vorbei bis auf die Mole rollen.

Wieder einmal erwies sich das Fahrrad im Verkehrschaos als überlegenes Gefährt. Durch die kreuz und quer stehenden Autos und Laster im Stop-and-Go-Verkehr hindurch, nutze ich jede Lücke und drang rasch bis zur Hafenmeisterei vor, wo ich am Schalter für 6,80 Pfund ein Ticket für die Überfahrt nach Kennacraig löste. Radfahren wird in Schottland honoriert, so kostete der Radtransport auf allen Fähren so gut wie nichts.
Obwohl tropfnass, fühlte ich mich gut, ich hatte mein Ziel erreicht und würde von der letzten Fähre an diesem Tag ans Festland mitgenommen. Kaum war der Laderaum geräumt, durfte ich privilegiert mein Rad als Erster die eiserne Rampe hinauf in den Schiffsbauch schieben. Ganz vorne am Bug war ein leerer Stauraum für Fahrräder reserviert. Noch war er bis auf einige Kartons leer, noch befand sich kein anderer Radler an Bord. Als erstes schnallte ich die Gepäcktasche mit der Wechselkleidung ab und beeilte mich über eine Gitterrosttreppe nach oben in die beheizte Lounge zu kommen.
Noch bevor die Bar aufmachte, suchte ich die Herrentoilette auf und pellte mich mühsam aus den triefnaßen Kleidern. Gleich neben der Tür hing ein großer Spiegel, in dem ich ein bleiches Gesicht mit Stoppelbart erblickte. Ich erschrak, doch nicht über die Erschöpfung auf der Haut, sondern über den Zustand meines linken Auges. Eine Ader war geplatzt und hatte die Iris flammend rot mit Schlieren durchzogen. Die Hetze zur Fähre im strömenden Regen war doch zu groß gewesen. Als ich das Malheur entdeckte, schrillten auch schon die Sirenen: Hetz dich nicht so, pass besser auf deine Gesundheit auf!
Natürlich ist ein Hyposphagma nichts Lebensbedrohliches und nach zehn Tagen in der Regel verschwunden, aber die geplatzten Äderchen unter der Bindehaut waren doch ein Hinweis auf eine zu große Anspannung, ein zu hoher Druck auf die Blutgefäße. Das blutunterlaufene Auge wurde zum Fingerzeig, den ehrgeizigen Wunsch zu ändern und nicht mehr bis Campbeltown durchzufahren. So gab ich diesen Plan schnell auf und entschied mich für ein Nachtquartier gleich hinter dem Hafen.
Kennacraig war nichts weiter als ein Ort des Kommens und Gehens. Am Kai stand lediglich ein einsamer Container mit Toilette, Stühlen und Thermoskannen für Wartende und einem Ticketschalter. Kein Hotel, kein B&B, kein Örtchen, um sein müdes Haupt auf ein Kissen zu betten. Kennacraig war ein Terminal auf einer aufgeschütteten Landspitze, die über eine kurze Nabelschnur am Festland hing und das Überleben von Islay garantierte.
Kaum hatte die Caledonia Ferry festgemacht, schob ich mein Rad noch vor den Automobilen über den platten, aufgeklappten Bug ins Freie. Ich beeilte mich, um warm zu werden, ich fror erbärmlich und wäre am liebsten unter eine Daunendecke gekrochen. Zudem hätte ich mich jetzt riesig über einen Whisky gefreut, einen Single Malt aus Campbeltown, wohin ich eigentlich hätte fahren wollen. Aber daraus sollte aus Gründen der Vernunft ja nichts mehr werden.

Nach einem kurzen Fußmarsch schwang ich mich ächzend in den Sattel und bog mit bleischweren Gliedern auf die A 83 gen Süden ein. Bereits an der ersten Kreuzung verließ ich die Hauptstraße wieder und folgte dem Ortsschild Whitehouse. Nur einen Steinwurf von Kennacraig entfernt, fand ich ein Zimmerchen für eine Nachtpassage, die ich traumlos durchquerte.
Eine freudige Überraschung erwartete mich am nächsten Morgen, als ich ausgeruht, magenfroh und wieder in trockener Funktionswäsche auf mein Fahrrad stieg. Der Wind hatte aufgefrischt und wehte nun aus Norden. Seine Richtung stimmte, meine auch, denn ich wollte nach Süden und da kam mir seine Hilfe gerade recht. Als ich wieder auf die A 83 einbog, griff er mir versöhnlich unter die Arme und ich glaubte schon an eine ausgleichende Gerechtigkeit des Himmels. Keine halbe Stunde später fing er an, mit mir zu spielen und entfaltete von Meile zu Meile seine ganze Kraft. Der Nordwind wurde zum Sturm und jagte mich derart bestimmend vor sich her, dass ich auf der Ebene im höchsten Gang eine Geschwindigkeit von 45 km/h erreichte. Solch ein Rennradtempo, das man mit geringem Tretaufwand erreicht, gaukelt einem vor, man hätte ein entriegeltes E-Bike unter dem Hintern. Während ich wie arbeitslos im Sattel saß und nur noch locker strampeln brauchte, genoss ich in voll Zügen das Bewegtwerden durch den Rückenwind. Aufmerksam richtete ich den Blick auf den Flug der Möwen über dem weißen Strand, lachte über ihr Kreischen und Balgen um einen Krebs oder einen angespülten toten Fisch zwischen den Felsen, die basaltschwarz und dick bemoost das Ufer säumten. Schon bald führte die Küstenstraße so nahe am Ufer entlang, dass ich mit dem Atlantik auf du und du Zwiesprache halten konnte. Er begleitete mich aus nächster Nähe, so nahe schob er seinen Körper an mich dahinflitzenden Radler heran, dass ich seinen sauer-fischigen Atem riechen konnte. Auf der A 83 bekam ich mein erstes großes Geschenk der schottischen Reise: In weniger als drei Stunden hatte das bepackte Trekkingrad mit mir Faulenzer im Sattel 57 Kilometer abgespult. So erreichte ich lange vor Lunchtime den Fischerhafen Campbeltown, den die alten Kelten noch Kinlochkilkerran nannten.
(Fortsetzung folgt)