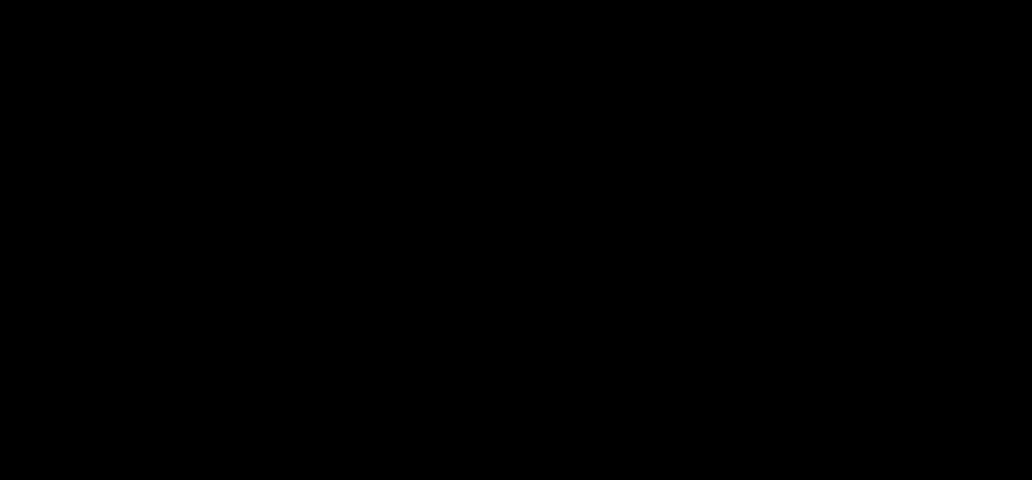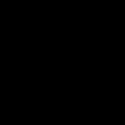Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 23)
Nicht mehr ganz taufrisch kletterte ich aufs Rad und fuhr direttissima zur Rampe der Caledonia Fähre zurück. Wieder das gleiche Spiel, diesmal zurück über den Sund aufs Festland. Angelandet am brachial in die Landschaft betonierten Pier, stieg ich eilends in den Sattel und versuchte vor den beiden mitgefahrenen Tanklastern der Glasgower Whiskyspedition Mundell Ltd. die erste Anhöhe zu erklimmen. Doch mein Vorsprung war zu gering, gewiss war ich auch schon zu ausgepowert, so dass ich im Dieseldunst der PS-Giganten hustend aufwärtsstrampeln musste. Erst als sie sich aus ihrer Abgaswolke davon gestohlen hatten, umarmten mich wieder gute Luft und der Frieden des Alleinseins.
Nach acht Kilometern war Schluss mit lustig, vorbei war es mit dem Komfort.
An der Einmündung zur geschäftigen A 83 entlang der Westküste von Kintyre wurde mein verpenntes Sträßlein jäh aus dem Schlaf gerissen. Ab sofort musste ich die Verkehrsdichte einer Autobahn auf der Enge einer Landstraße erdulden. Zum Glück nicht lange, denn bereits nach drei Kilometern fand ich den Hinweis auf einen Radweg, der im Gebüsch parallel zur Autostraße verlief. Die frisch geteerte Trasse war so neu, dass sie kartographisch noch nicht erfasst war, aber das scherte mich nicht, da ich eh ohne papierene Radkarte unterwegs war.
Natürlich musste ich mich orientieren und in der Fremde zurecht finden, allerdings dienten mir dazu der Sonnenstand, Hinweisschilder oder auch die Auskunft der Einheimischen vor Ort. Wenn ich mal in einem Labyrinth verloren ging, dann nutzte ich als letzte Möglichkeit die digitale Standortbestimmung meines Handys. Doch der Rückgriff auf das GPS von unterwegs kam nur in Frage, wenn ich mich mal so richtig verfranzt hatte, was vor allem im urbanen Kosmos oder im Wirrwarr der Ausfallstraßen großer Städte vorkam. In der Regel bereitete ich mich gründlich und rechtzeitig vor. Immer am Vorabend brütete ich über dem GPS Routenplaner und notierte auf einem Zettelchen die Namen der nächsten Orte, die Kreuzungen und die Abbiegungen, die ich am nächsten Tag auf einer möglichst radgerechten Route nehmen musste. Diesen Spickzettel trug ich in der Brusttasche bei mir und zog ihn im Notfall sogar im Fahren heraus.
An der Kreuzung zur A 83, die den Islay-Verkehr von und nach Glasgow lenkt, stand auf dem schwarzweißen Straßenschild: Tarbert, darunter Ardrishaig und die Distanz von 32 Meilen. Im ersten Augenblick hörten sich 32 Meilen bis Tarbert lässig an und ich sagte zu mir, das reißt du schnell mal runter. Aber kaum, dass die grauen Zellen zu rechnen anfingen und als unumstößliches Ergebnis auf ganze 51 Kilometer kamen, verließ mich der Elan und augenblicklich fühlten sich die Beine bleischwer an. Ich überlegte: 32 Meilen bis Tarbert, das wäre die kürzeste Entfernung, allerdings eingekesselt in die Hektik des Autoverkehrs. Doch was bot sich mir für eine Alternative? Ja, es gab sie, die untergeordnete B 8024, auf der der Caledonia Cycle Path, auch National Cycle Route 78 genannt, verlief. Auf dieser ruhigeren Radroute würde sich allerdings die Strecke auf 64 Kilometer summieren. Wir hatten bereits späten Nachmittag und bis zur Dämmerung war mein Zeitfenster nicht größer als drei Stunden. Dieses Zeitlimit gab mir zu denken. Nun ja, acht Meilen Unterschied, das hörte sich weiß Gott nicht wie eine Tour de France-Etappe an. Richtig, aber wenn man schon so viele Meilen wie ich an diesem Tag zurückgelegt hat, dann zählt jeder Meter.
Für ein mit dem metrischen System großgewordenes Gehirn ist das Umdenken von Kilometer in Meile, von Meter in Yard und von Kilogramm in Pfund eine mühsame Schädelübung. Als ich die ersten Tage von Edinburgh nach Glasgow am Union Canal entlangfuhr, nahm ich die Meilendistanz von einem Ort zum nächsten noch auf die leichte Schulter. Vermutlich, weil ich die angelsächsische Extrawurst nicht annehmen wollte, nahm ich sie unreflektiert 1:1 wahr. Tatsächlich aber erstreckt sich eine Meile auf einer Länge von 1609 Metern, also nicht viel weniger als das Doppelte an Entfernung.
Unschlüssig schaute ich in den Himmel, würde das Tageslicht noch ausreichen? Längst hatte die Sonne den Zenit überschritten und es ging bereits auf 5.00 p.m. zu. Besser, ich wählte die kürzere Strecke, die Autostrecke, auch wenn der Stoßverkehr von PKW und LKW mit Bulkwhisky, Gerste oder Versorgungsgütern aller Art aus Campbeltown und Islay heftig an den Nerven zerren würde. Aber weitere 51 Kilometer waren an diesem langen Tag, mit dem Abstecher nach Arran, und einer Verkostung wirklich mehr als das Höchste der Gefühle. Schließlich musste ich ja auch noch an die Quartiersuche denken.
Gut, inzwischen hatte ich eine beachtliche Kondition aufgebaut, aber weitere 51 Kilometer bis nach Ardrishaig am Ufer von Loch Tyne waren für den Rest von Nachmittag ein überaus ehrgeiziges Ziel. Kurzentschlossen schminkte ich mir die verkehrsarme, 14 km längere Strecke auf der Radroute 78 ab und wählte den Autostress auf dem kürzesten Weg nach Loch Fyne.
Loch Fyne ist ein ziemlich altes Gewässer – entstanden vor 200 Millionen Jahren. Über eine unvorstellbar lange Zeit war der Loch von einem zwei Kilometer starken, sich unendlich langsam bewegenden Eispanzer in die Landschaft gefräst worden und zwar so tief, dass er Teil des urzeitlichen Tethysmeers wurde. Nach dem Abschmelzen der Gletscher hoben sich einst die befreiten Erdschichten und senkten sich nie wieder auf das Niveau des Meeresspiegels ab. Dieser Lifteffekt hatte zur Folge, dass aus Loch Fyne ein tiefer Binnensee wurde, der sein Süßwasser seitdem aus ober- und unterirdischen Flüssen bekommt. Aber nicht nur Loch Fyne wurde so geschaffen, sondern alle Firths, Lochs und Lochans, alle Buchten, Seen und Seechen entlang der schottischen Küste. Loch ist übrigens ein Begriff aus dem Gälischen und stammt vom lateinischen lacus ab, was See bedeutet. Diese Begriffsdefinition und mehr hatte ich einst in Latein unter Kopfzerbrechen lernen müssen.
Am Westufer von Loch Fyne radelte ich staunend entlang, immer wieder zog das Ostufer meine Blicke auf sich. Drüben über dem fernen Ufer schwebte bereits der Dunst des Abends. Über dem Wasser stiegen die ersten rauchzarten Schleier empor und nahe bei mir wuchsen die Schatten der Uferbäume in die Länge. Kaum merklich verdunkelte sich der Loch, und als seine Wellen vom Abendwind weiße Kämme aufwarfen, wähnte ich mich in einer erwachenden Zwischenwelt: halb Erde – halb Meer. Beim Queren der Landschaft von Argyll and Bute spürte ich noch immer die Eiszeit, die vulkanische Erruption. Überhaupt, das Land, das ich durchfuhr, atmete noch immer die urzeitliche Energie.
Im verlöschenden Abendlicht querte ich einen Landstrich rollender Hügel, deren weiche Silhouette mir den Atem nahm. Aber auch die Auffahrten, die sich nun häuften, ließen mich auf ihre Art und Weise staunend schauen. Während mein Blick vagabundierte, hämmerte das Herz maschinengleich und trotz der abendlichen Kühle rann mir der Schweiß von der Stirn. Noch kam ich zügig voran, dank meines treuen Begleiters und Freunds, des Atlantikwinds, der von Irland herüberwehte.
Tarbert durchfuhr ich ohne Halt, und gleich hinter dem Ortsende sah ich mich verwirrt in alle Richtungen um – war ich an der spanischen Riviera gelandet? Ab jetzt rückte die A 83 bis auf wenige Meter an die Sandstrände von Loch Fyne heran, und ich hätte mit dem rechten Fuß ins Wasser patschen können. Der Blick über den zur Ruhe gekommenen Wasserspiegel sorgte für Gleichklang beim stetigen Pedalieren auf rauhem Asphalt. Aber wenig später war mit dem Vagabundieren wieder Schluss: höllisch musste ich achtgeben, dass mich der dichte Verkehr nicht in den vermüllten Straßengraben abdrängte.
Hinter Erines wurde es richtig eng, aus Sicht des Autoverkehrs wurde ich zum Hindernis, denn nur bei freier Gegenfahrbahn konnte er mich überholen. Auf keinen Fall wollte ich einen Unfall riskieren, also trat ich schneller und nahm dafür ein Brennen in den Oberschenkeln in Kauf. Um alles in der Welt wollte ich die enge Passage rasch hinter mich bringen. Von wegen absteigen und die Steigung zu Fuß meistern! Für einen Radfahrer, der neben seinem Vehikel ging, war kein bißchen Platz. Die Straße und ich als ihr Sklave mussten über einen Felsriegel hinweg, da half kein Vertun. Wenig später kam es richtig dicke: Achtung 12 % Steigung warnte ein rotweißes Schild.
Zwar stand alle hundert Meter in verschobener, schmutzig weißer Schrift „slow“ auf dem ausgewalzten Asphalt, aber viele hielten sich nicht an diese Aufforderung und wieder einmal wurde deutlich, dass die Langsamkeit zur Philosophie des Cyclisten, nicht aber zu der des Motoristen gehört. Gewiss wollten alle, die mich mit Karacho überholten, noch vor Einbruch der Nacht in Glasgow sein. Am Scheitel der aufwärts führenden Kurve hoffte ich inständig, dass es gleich wieder abwärts ging – aber nein, ich musste weiter, weiter bergauf. Kaum, dass der Puls hochschnellte und der Schweiß von der Stirn brennend in die Augen tropfte, begann ich mit mir zu hadern: warum dieser Ehrgeiz, warum bist du nicht in Tarbert geblieben?
Viele Radfahrer und Sportler ärgern sich über den inneren Schweinehund, ich ärgerte mich über seinen Gegenspieler, den Ehrgeizling. Ohne Frage, ich hatte mich überfordert. Sollte ich auf der Stelle kehrtmachen und nach Tarbert mit Schwung zurückfahren? überlegte ich ernsthaft. Aber was hieße das für den folgenden Tag?
Die Tortur nur aufschieben!
Sollte ich auf der Stelle eine Trinkpause einlegen? Nicht einmal das ging, dafür fehlte der Platz, die Uferböschung endete jäh am Straßenrand. Angestrengt fuhr ich weiter und weiter und bilanzierte missmutig, dass ich mir mit meinem Draufgängertum bis dahin eine Distanz von 95 Kilometern eingebrockt hatte. Und die Tagesetappe war immer noch nicht vollendet. Zum Glück blieb es am Abend bereits länger hell. So erreichte ich, zwar unterkühlt, aber unfallfrei, gegen 20 Uhr das grau in grau daliegende Ardrishaig. Eigentlich wollte ich es nun gut sein lassen, aber im 1300-Seelen-Dorf fand ich nirgendwo ein Hotel oder ein B&B.
Im Tante-Emma-Laden von Ardrishaig, wo ich eine Flasche Wasser und eine Packung Kekse kaufte, meinte die Kassiererin, in Lochgilphead würde ich gewiss eine Unterkunft finden. Also weiter, weiter nach Norden ins Argyller Land hinein. Fünf Meilen später ebbte der Autoverkehr ab und ich konnte endlich wieder abgasfreie Luft atmen. Am Ende des Lochs zweigte rechter Hand der Schwerverkehr nach Glasgow ab, während ich geradeaus weiterfuhr. An einem Kriegerdenkmal kam ich vorbei, und als ich in meiner Erschöpfung die steingemeißelte Huldigung gefallener Veteranen passierte, kam mir der Gedanke, dass ich müder Krieger eigentlich auch eine Ehrung verdient hätte.
Völlig fertig von einem dreizehnstündigen Satteltag, landete ich in einem Straßendorf, dessen staubgraue Fassaden von rußigen Schlieren, schimmeligen Regenflecken und wuchernden Moospolstern gesprenkelt waren. Auf dem Zahnfleisch hatte ich mich hinter Lochgilphead die letzte Steigung hinaufgequält. Inzwischen war mir alles egal, nicht das geringste Verlangen nach Komfort keimte noch in mir – nur noch die kaputten Knochen ablegen und unter einer warmen Decke verschwinden!
Abgesehen von der Begegnung mit dem Ehrgeizling und der daraus resultierenden Erkenntnis, in Zukunft die Kräfte besser einzuteilen, lernte ich an jenem langen Fahrtag das Für und Wider einer permanenten Erreichbarkeit kennen. Der digitalen Revolution war es zu verdanken, dass ich einen Reifenabdruck im hintersten Winkel von Schottland hinterließ und dem Internet meine Route und mein Tempo unbeabsichtigt mitteilte.
Aus meiner Jugend kannte ich eine derartige Verfügbarkeit nicht. Auf meinen früheren Reisen per Autostop nach Spanien und Nordafrika schickte ich Briefe oder Postkarten, geschmückt mit exotischen Briefmarken, an Familie und Freunde. Und von Zuhause erhielt ich, wenn ich mal wieder für vier, fünf Wochen unterwegs war, eingeschriebene Zeilen von meinem Vater oder meiner Freundin als poste restante in Malaga, Tunis, Algier oder Rabat.
Heute funktioniert die weltweite Kommunikation mit einem Klick, einem Wusch, und die WhatsApp-Botschaft, gesprochen oder geschrieben, ist gleich tausende von Kilometern geflogen. Genauso gut klappt es mit dem Versenden von Bildern. Aber eben auch die weniger erfreulichen Nachrichten, Nachrichten über Steuernachzahlungen oder Krankheiten von Verwandten und Freunden, über die Mätzchen der zurückgelassenen Freundin, also über Bedrückendes, erreichten mich an diesem Fahrtag und saßen mir während der stundenlangen Beinarbeit wie eine Zecke im Nacken.