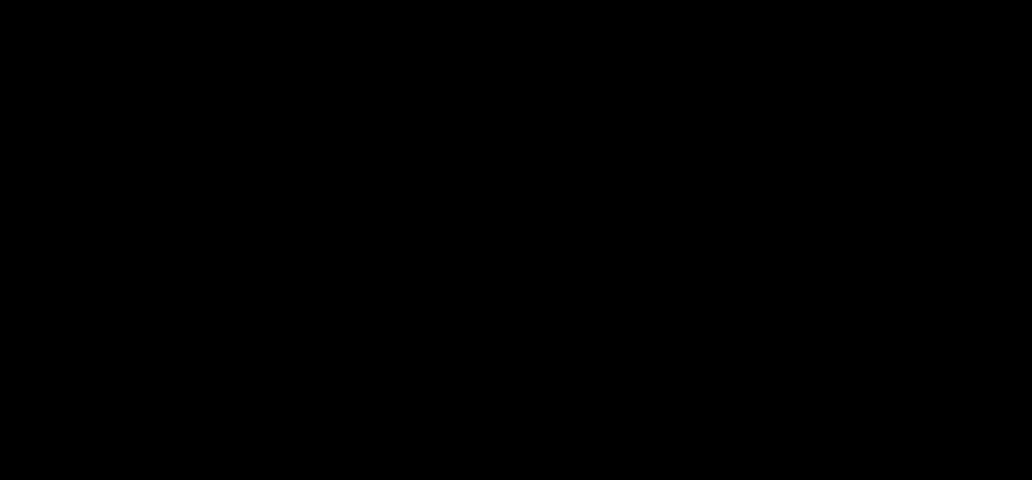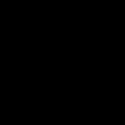Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 25)
Länger musste er den passenden Schlüssel suchen, dann schloss er die Haustür auf und zeigte die ausgetretenen Stufen einer abgewetzten Holztreppe hinauf. „Ganz oben unter dem Dach ist ein schönes Zimmer frei, ich geb’s dir für 30 Pfund. Schau’s dir in Ruhe an, ich warte hier unten.“
Die verschwitzten Radklamotten waren inzwischen schon wieder trocken, aber die Schmerzen hinter den pochenden Schläfen nahmen zu, als ich zur obersten Etage hinaufstieg.
Oben fand ich ein Nachtasyl der schäbigsten Sorte vor. Rauchschwanger, regelrecht abgehangen, stand alte Luft hinter löchrigen Gardinen im Mansardenzimmer. Durchgelegen waren die Matratzen des Doppelbetts aus den vierziger Jahren und das Klosett im fensterlosen, toten Raum konnte ich nur im Schummerlicht erahnen, weil die Deckenlampe nicht funktionierte. Erschwerend kam hinzu, dass ich in jedem Fall die urinmüffelnde Schüssel mit einem Fremden hätte teilen müssen. In der winzigen Duschkabine hing wieder so ein befremdliches Gerät, allerdings eines der ersten Generation, das noch bauchiger und schäbiger aussah. Nein, danke! Nach einem langen Radtag verlangte es mich nach etwas Gemütlichkeit und für den folgenden freien Tag nach dem kleinen Komfort. Mit verhärteten Muskeln stakste ich die Treppe wieder hinab und sagte zu ihm: „Sorry, no!“
Lässig eine Zigarette rauchend, lehnte er am Geländer und entgegnete trocken: „Ok, aber für 30 Pfund darfst du nichts erwarten.“
Recht sollte er behalten, auf meiner ganzen Reise sollte ein Zimmer mit Frühstück mindestens 50 Pfund kosten. Als ich meinen Helm wieder überstülpte und das rechte Bein, gefühlte zwei Zentner Muskel- und Knochenmasse, über das Oberrohr hob, trat er nochmals auf mich zu und zeigte verschwörerisch die Straße in Richtung Zentrum hinab. „Komm doch morgen bei meinem Friseursalon vorbei, er liegt dort hinten am Ende der Straße, gleich bei der Destillerie.“
„Mal sehen“, rief ich ihm noch über die Schulter zu, dann trat ich hastig in die Pedale. Einfach weg, nur weg aus dem Dunstkreis dieses halbseidenen Typen. Abwärts zur Uferpromenade ließ ich das Rad rollen, bis es am gewaltigen Kasten des Alexandra Hotels zum Stillstand kam. Auch dort fragte ich an der Rezeption nach einem Zimmer.
„Sorry, no vacancies!“, flötete es hinter dem bauchigen Monitor hervor, „aber Sie können es ja an der Promenade stadtauswärts noch versuchen, dort gibt es viele Villenpensionen.“
Ich nickte und verschwand, bevor mir der schnatternde Pulk einer Busgesellschaft mit sperrigen Rollkoffern den Fluchtweg ins Freie versperren konnte.
Schon dämmerte es, als ich endlich im Anbau einer Gründerzeitvilla ein frisch renoviertes Apartment mit King Size-Bett und Flatscreen-TV fand. Ganz zu schweigen vom Badezimmer mit Bidet, schneeweißen Handtüchern und einer gläsernen Duschkabine, die sogar ohne Wasserdruck-Durchlauferhitzer heißes Wasser lieferte. Das obligatorische Set aus Keksen, Teebeuteln, Nescafé-Tütchen, Minicontainer für Milch und zwei Tassen sowie einem Wasserkocher war noch um ein Minifläschchen hochprozentigen Oban erweitert. Mein Herz lachte beim Anblick dieser üppigen Willkommensgabe und gerne bezahlte ich das geforderte Sümmchen, das verdammt noch mal ein gehöriges Loch ins Portemonnaie riss.
Die verschwitzten Kleider zog ich noch aus, während ich schon über die Kekse herfiel, erst dann nahm ich eine Dusche zusammen mit der Radhose und dem Hemd, auf denen ich wie ein Waschweib herumtrampelte, um sie mit dem schaumigen Brauchwasser sauber zu kriegen. In einem Aufwasch reinigte ich also mich und meine müffelnde Wäsche. Der heiße Wasserstrahl spülte Erschöpfung und Nervosität von der Haut, und fröhlich sang ich unter der heißen Dusche das Lied vom schwäbischen Uli, der seiner Sparsamkeit ein Schnippchen geschlagen und 200 Pfund losgelassen hat.
Am nächsten Morgen war ich froh, dass ich den Anorak nicht mit in die Dusche genommen hatte, denn ich brauchte ihn, um trocken über den Parkplatz zum Frühstücksraum in der nahen Villa zu gelangen. Lange hatte ich geschlafen, so waren die meisten Tische bereits abgeräumt und ich konnte ungestört nahe dem Buffet Platz nehmen. Nach dem bescheidenen Keks-Abendessen nagte ein so gewaltiger Hunger an mir, dass mir unversehens die Geschichte „Die Liebe zum Leben“ von Jack London einfiel.
In dieser knappen Erzählung geht es um den Überlebenskampf eines einsamen Goldsuchers in der Einöde am nördlichen Eismeer, der kurz vor dem Verhungern steht und nur deshalb nicht verendet, weil er mit letzter aufwallender Kraft einem kranken und ebenfalls hungernden Wolf die Kehle durchbeißt und dessen Blut trinkt. Das Wolfsblut gibt ihm gerade soviel Kraft, dass er die letzten Meter zu einem ankernden Walfänger hinkriechen kann. Auf dem Schiff erholt sich er sich zwar körperlich, aber psychisch kann er nicht gesunden. Heimlich und zwanghaft sammelt er Schiffszwieback, immer nur Zwieback aus der Kombüse. Als man ihn Wochen später tot in seiner Kajüte entdeckte, „barst die Koje von Schiffszwieback“.
An diese Geschichte erinnerte ich mich, weil ich auf der Sitzfläche meines Nachbarstuhls eine Tupperdose, vom Buffet aus nicht einsehbar, platziert hatte. Kaum war der erste Hunger gestillt, füllte ich sie mit geschmierten Toastbroten, drei hartgekochten Eiern, zwei Joghurts und zwei Küchlein. Zwei Äpfel steckte ich mir auch noch in die Tasche. Es war mir bewusst, dass ich gegen guten Anstand verstieß, und ich erinnerte mich an die gängige Büfet-Anweisung „Essen Sie sich satt, aber nehmen Sie nichts mit!“ So will ich mich an dieser Stelle reumütig für das Mitgehenlassen von 800 Kalorien entschuldigen.
Magentechnisch aufgerüstet, stand ich schließlich vom Frühstückstisch auf und schlurfte schweren Schritts in mein Zwei-Zimmer-Apartment im Nebengebäude. Matt warf ich mich aufs Bett, während mein Magen-Darmtrakt gurgelnd in Fahrt kam. Eigentlich ist ein derart unmässiges Nahrungsverlangen nur eine Ausgeburt des kognitiven Verlangens, dachte ich im Liegen und musste an die Behauptung von Yuval Noah Harari denken, dass noch immer die Gene der Steinzeitjäger, deren Leben sich zwischen Sattessen und Hungern abspielte, im modernen homo sapiens lebendig sind.
Gegen 11 Uhr beendete ich die frühe Siesta, hängte die Radwäsche zum Trocknen auf den Röhrenheizkörper im Bad, zog ein T-Shirt und den weißen Ausgehpulli über und schlüpfte in die Jeans und die weißen Sneakers. Den Anorak packte ich unter den Arm genauso wie die Umhängetasche mit dem Bargeld und wichtigen Utensilien. So großstadtfein verließ ich das Haus, nicht ohne nach dem Rad in der Garage zu schauen.
Voller Erwartungen verließ ich zu Fuß mein mondänes Domizil und erreichte schon nach wenigen Schritten die Uferstraße, die in die Esplanade einmündete. Nahe am Wasser stutzte ich, weil mir die Orientierung abhanden gekommen war: hatte ich nun Festland unter den Füßen oder spazierte ich am Saum einer Insel entlang? Ernsthaft stellte ich mir diese Frage, als ich auf das graugrüne Wasser der Bucht von Oban hinaussah.
Die schottische Atlantikküste ist derart zerklüftet und unübersehbar mit Archipelen von Inseln bestückt, dass man sich zurecht an vielen Orten am Wasser diese Frage stellt. Lediglich auf der Landkarte zeigt sich die Topographie der vielen küstennahen Inseln überschaubar, und nur auf der Landkarte kann man Festland und Inseln wirklich auseinander halten. Aber was heißt schon Festland! Leicht wird vergessen, dass man auf einer ganz großen Insel steht.
Ein Wirrwarr von Inseln und Inselchen breitete sich schon oft vor meinem Vorderrad aus, wenn ich einen Hügelrücken in Küstennähe erklommen hatte. Sobald ich dann durch die Ansammlung und Abfolge von weiteren Hügeln und Höhen fuhr, erblickte ich vor mir plötzlich einen flachen Streifen Land und dahinter einen mehr oder weniger breiten Wasserstreifen, der gegen den Horizont wiederum von einem grünen Hügelrücken bedrängt wurde. Begegnete mir solch eine Land-Wasser-Formation fragte ich mich, ist das nun ein Sund mit Meereszugang oder ein Loch oder nur ein kleiner See, ein Lochan? Einmal hätte ich schwören können, ich radelte an einem lieblichen Seeufer entlang, bis zu dem Augenblick, als sich plötzlich eine Hochseefähre ins Bild schob und mir schlagartig bewußt wurde, dass kein Loch vor mir lag, sondern ein Sund, ein besonders vorwitziger Meeresfinger, der sich tief ins Landesinnere vorgewagt hatte.
Als ich nun an der Promenade von Oban aufs graugrüne, von Regentropfen porös aufgebrochene Wasser schaute, ragten die hügelige Insel Mull und eine vorwitzige Festlandnase in mein Blickfeld und bildeten hinter dem Wasserstreifen eine grüne Kulisse gegen den Horizont. Diese Enge wirkte schmal, aber tatsächlich wurde sie vom Meer durchflossen.
Zu meinen Füßen herrschte Ebbe, der Atlantik hatte sich zurückgezogen, aber trotzdem war ich nicht alleine. Scharen von Seemöwen flogen neugierig über mich hinweg, drehten bei und kamen zurück, wohl in der Hoffnung, dass der spendable Tourist womöglich ein Fresstütchen bei sich trug. Ganze Vogelscharen fielen kreischend aus den Wolken und segelten zum Greifen nahe über den verschlickten und säuerlich-fischig riechenden Strand, an welchem ich entlang stadteinwärts spazierte. Vermutlich wunderten sich die fliegenden Späher über meinen hölzernen Gang, einen Gang, der von strapazierten Knien herrührte. Ja, beide Knie schmerzten beim Gehen und, ehrlich gesagt, kamen sie mir vor wie eingerostete Scharniere. An diesem Tag durften sie sich regenerieren und ihre alte Geschmeidigkeit wiedererlangen, heute hieß es: no cycle, only sip!
Gegen das gelegentliche Tröpfeln aus einem inkontinenten Himmel schützte mich der schwarze Anorak, der zwischen den schlammfarbenen Outdoor-Anoraks der bummelnden Touristen nicht auffiel. Wie ich die George Street entlanglief, am dritten Tattoo & Body Piercing, am fünften Gift & Souvenirshop und an einem neueröffneten E-Zigaretten-Laden vorbei, stockte mein Schritt vor dem Schaufenster eines Radladens. Kein bisschen prüde hing zwischen Luftpumpen und Trikots im Schaufenster ein Spruch, den ich so eindeutschen würde: „Mein Fahrrad und ich: Man könnte es fast Sex nennen. Es quietscht, ich stöhne.“ War das nun eine schwarzhumorige, schottische Spruchweisheit? Oder eine Verarschung von Leuten wie mir? Kurz überlegte ich. Nein, auf mich konnte dieser anzügliche Spruch nicht zutreffen – eine libidinöse Beziehung zu meinem Fahrrad ging mir gänzlich ab. Im Gegenteil, die momentane Enthaltsamkeit fühlte sich ganz wunderbar an. Schmunzelnd schlenderte ich weiter, denn aus dem Radladen brauchte ich nichts, nicht einmal ein Tröpfchen Schmieröl. Mein Trekkingrad hatte die bisher gefahrenen 520 Kilometer ohne quietschen gemeistert und genau für diese Geräuschlosigkeit liebte ich es bedingungslos.
Am Ende der George Street fiel mir im stockenden Verkehr ein kirschroter Porsche auf. Genau! Der Cayman! Er parkte vor einem Friseursalon, und wie ich langsam an dessen großer Sichtscheibe vorbeischlenderte, winkte mir der rotblond Toupierte von drinnen zu. Verhalten winkte ich zurück und machte mich gleich aus dem Staub, damit er mich nicht in seinen Laden locken konnte. Jetzt stand ich an der Kreuzung, wo die enge Stafford Street anfing und von wo aus ich den Eingang der Oban-Destillerie auf der anderen Straßenseite erblicken konnte.
Die Brennerei war umzingelt von strotzenden Gebäuden mit hohen Dächern und armierten Balkonen und wirkte wie eingezwängt. Als sie im Jahr 1793 gegründet wurde, konnten die Gebrüder Stevenson nicht ahnen, dass schon bald rings um ihre Mälzerei, ihr Brennhaus und das Fasslager herum Manufakturen, Wohn- und Geschäftshäuser und Hotels gebaut würden. So befindet sich die Brennerei heutzutage in einer Art steinernem Korsett und kann ihre Produktionsstätte nicht erweitern. Dieser Nachteil hielt allerdings den Spirituosengiganten Diageo nicht davon ab, die Destillerie zu kaufen und sie ins Portfolio seiner 28 Destillerien aufzunehmen.
Anscheinend kommt die neue Direktion mit dem Platzmangel gut zurecht, vor allem deshalb, weil im Haus nicht mehr gemälzt, sondern die ready-made-Gerste in Tanklastern angeliefert wird. Ebenfalls aus Platzmangel wird der gereifte Whisky als Bulkwhisky nach Glasgow gefahren und dort in der Diageo Abfüllfabrik verdünnt und auf Flaschen gezogen. Den Marketing-Strategen von Diageo gelang es geschickt, aus dem Standortnachteil einen werbewirksamen Vorteil zu konstruieren, indem sie das heute sehr selten vorzufindende Spezifikum „urban distillery“ weltweit vermarkten.
(Fortsetzung folgt)