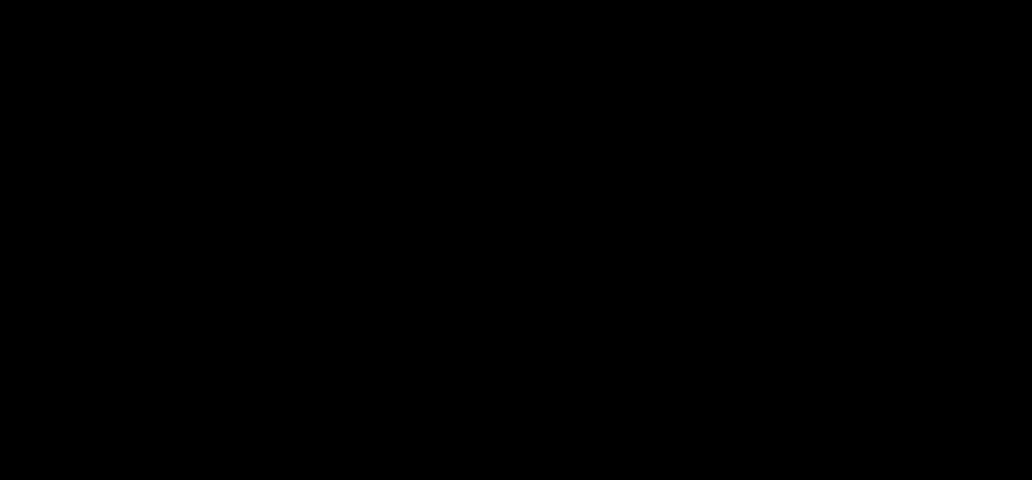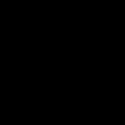Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 44)
Beim Blick auf die hochgelegene Brennerei entfuhr mir ein Seufzer: Mensch, da musst du hinauf, das wird noch `ne schöne Schinderei! Zum Glück hatte die Auffahrt noch Zeit, erst einmal durfte ich einen Hang traversieren, und anschließend konnte das Rad mit wenig Rollwiderstand das Gefälle nach Bridgend of Livet hinab nehmen.
Kurz vor dem Ortsschild zog ich die Bremsen: zwischen den Kronen alter Eichen spickte mein erstes Ziel hervor, eine steinerne Brücke. Sie war mir schon begegnet, zwar nicht in Echt, aber auf der The Glenlivet Flasche, dort am Hals wird sie als Relief dezent vignettiert. Das altertümliche Bauwerk war allemal sehenswert, deshalb bremste ich mich aus und beendete den Downhill, um sie mir genauer anzuschauen.
Kristallklar tanzte knietiefes Wasser um bemooste und rundgeschliffene Granitblöcke herum und schlängelte sich unter den drei Rundbögen der alten Steinbrücke hindurch, so weich und frisch, dass ich es am liebsten mit der hohlen Hand geschöpft und getrunken hätte. Kurz schloss ich die Augen, lauschte seinem Gurgeln, Murmeln und Glucksen, ja, für einen Moment beamte ich mich aus der Wirklichkeit weg und landete in Phantasia – oder erlebte ich für einen Wimpernschlag ein Déjà-vu mit früheren Zeiten, als vor Jahrhunderten Maultiere und Fuhrwerke, beladen mit Whiskyfässern, die Steinbrücke querten?
Wie all die Ruinen von Burgen, Schlössern und Herrensitzen war auch dieses Monument Zeuge früher Lebensumstände, als Speyside noch von den Kelten besiedelt war. In der Phantasie war es ein Leichtes, in der Zeit zurückzureisen. Dieses Kunststück gelingt dem Radreisenden nicht nur wegen der Luftigkeit der Gedanken, sondern auch dank der langsamen Art seiner Fortbewegung, die ihn seiner Umgebung ganz nahe bringt und einen mikroskopischen Blick auf das Nächstliegende und Umgebende erlaubt.
Wäre ich nicht zu Rad, sondern im Auto auf der neuen, erheblich höher angelegten B 9008 gekommen, hätte ich gewiss die keltische Steinbrücke übersehen. Die Harmonie der drei gleichen Rundbögen erinnerte mich an die Trinität eines gelungenen Whiskys, bei dem Aromen, Mundgefühl und Finale perfekt zusammenspielen – und schon lief mir das Wasser im Mund zusammen. Schade! Die Brücke stand nicht im Schlaraffenland, sondern im tiefen Tal von Livet! So baute sich vor einer wohlverdienten Verkostung noch die Hürde einer Bergfahrt auf.
Wieder zurück im Hier und Jetzt, strampelte ich im kleinsten Gang gehörig schwitzend die letzte Anhöhe zur Brennerei hinauf, die über dem Tal herrschaftlich thronte. Tüchtig schnaufend erreichte ich den Parkplatz am langgestreckten Lagerhaus. Voller Respekt sah ich mich um, ringsum alles aufgeräumt, modern und sehr beeindruckend in den Ausmaßen. The Glenlivet zeigte sich als eine gigantische Whiskyfabrik, und mit 14 Millionen verkauften Flaschen im Jahr ist die Brennerei der zweitgrößte Malt Erzeuger weltweit.
An der Rundtreppe zum Visitors Center schloss ich das Fahrrad am Geländer an und eilte in kurzer Stretchhose und Turnschuhen die Stufen hinauf, so schwungvoll, dass mir eine Gruppe Senioren erschreckt auswich und ans Geländer flüchtete. Sorry, die Beine waren halt noch in Schwung und tüchtig Adrenalin schwappte auch noch im Blut. Zur Wiedergutmachung empfing ich die älteren Whiskyliebhaber oben am Eingang und hielt ihnen die gläserne Schwingtür auf.
Auch hier betritt der Besucher als erstes den ehemaligen Mälzboden, einen Saal mit dem allzu bekannten Interieur, mit einem langen Verkostungstresen, harten Stühlen an langen Tischen, Vitrinen und Ständern mit Reklameprodukten, mit schlammfarbenen und schwarzen Jacken, T-Shirts und Kappen, diesmal mit dem „The Glenlivet“ Logo. All das war für mich mittlerweile kalter Kaffee, als ich aber in einer Wandnische ein Bild entdeckte, war ich wie wachgerüttelt. Spotbeleuchtet und gerahmt, hing dort das Gemälde „Kampf um das Fass“ an der weißgetünchten Wand. Der Genremaler John Pettie hatte einen Zweikampf in Öl gemalt, so realistisch, dass mir ein Schauer über den Rücken lief.
Ein verwahrloster, barfüßiger und klapperdürrer Mensch mit rotem Zauselhaar will einem Dicken einen Dolch ins Herz rammen, doch dieser hält das Handgelenk des Dürren umklammert und wehrt mit kraftvollem Arm die gezückte Waffe ab. Obwohl die Gegner nicht unterschiedlicher hätten sein können, wogt der Nahkampf unentschieden. Bei dem Abgerissenen mit dem flammend roten Haar handelt es sich um einen Schwarzbrenner, bei dem Beleibten um einen Steuereintreiber, einen exiseman. Der Staatsbeamte in Zivil ist nicht nur wohlgenährt, sondern auch noch gut gekleidet, in Gamaschenschuhen und einem wetterfesten Ölmantel, aus dessen Tasche der Knauf einer Pistole lugt. Das kleine Whiskyfass, um das sie kämpfen, liegt hinter dem Schwarzbrenner am Boden, es ist sein einziges Hab und Gut, zurecht verteidigt er es mit seinem Leben. Während ich sinnend vor dem gemalten Bild stand, wurde es zum Kaleidoskop der Whiskygeschichte.
Bereits im hohen Mittelalter brannten die schottischen Bauern einen groben Sprit, der zwar jede Menge Feuer in die Kehle brachte, aber gerade mal die Bezeichnung Rachenputzer verdiente, auf keinen Fall den hochwürdigen Namen uisge beatha, Lebenswasser. Als Untertanen waren sie vom König legitimiert, sich und andere mit Selbstgebranntem zu versorgen, aber nur bis zum Jahr 1579, ab dann mussten sie für jede überschüssig destillierte Gallone eine Abgabe entrichten. Als es der Obrigkeit irgendwann dämmerte, dass sie die Menge an privat Gebranntem unmöglich kontrollieren konnte, verschärfte sie die Auflagen im Jahr 1774 drastisch. Nicht mehr das Getränk, sondern die Gerätschaften wurden ins Visier genommen. Ab jetzt wurden alle privaten Destillierhelme für Rohbrand mit weniger als 1800 Litern Inhalt und alle kupfernen Brennhüte für den Feinbrand mit weniger als 450 Litern verboten. Mit der neuen, raffinierteren Methode, eben dem Zugriff auf die Gerätschaften, waren die bäuerlichen Kleinbrennereien viel leichter zu kontrollieren. Ausgedacht hatten sich diesen cleveren Schachzug nicht die Behörden, sondern die reichen Großbrenner, die alles daran setzten, die Macht der bäuerlichen Kleinbrenner zu schwächen, um sie bei erstbester Gelegenheit zu brechen. Doch so einfach klappte das nicht, immerhin gab es über zweitausend Kleinbrennereien, verstreut über das ganze unwegsame Land. Folglich gebar die Maßnahme heftigen Widerstand, Schwarzbrennen und Schmuggeln eskalierten zu einer stillen Revolte gegen die Obrigkeit und ihre Lobby unter den Großbrennern. Dummerweise suchte die Regierung nicht den Frieden, sondern verschärfte die Lage, indem sie den Kleinbrennern die Pistole auf die Brust setzte: entweder ihr lasst die Finger von der Schwarzbrennerei und erwerbt gegen eine horrende Alkoholsteuer eine Brennlizenz. Oder ihr riskiert, dass euer gesamter Besitz, nicht nur die Destilliergeräte und Eichenfässer, sondern auch Vieh, Pferde, Häuser und Ländereien, konfisziert wird.
Der Volkswiderstand, der sich dagegen rührte, war gewaltig und teilweise so blutrünstig wie auf dem Gemälde an der Wand. Es sollte ganze zwei Jahre dauern, bis er gebrochen und im Jahr 1781 das Schwarzbrennen per Dekret verboten war. Furcht und Wut verbreitete dieses Verbot, denn das enteignete Hab und Gut wurde an die wohlhabenden Grundbesitzer und Handelsherren mit neuerworbener Brennlizenz verkauft, worauf diese feinen Herrschaften nichts Eiligeres zu tun hatten, als ihre staatlich genehmigten Destillerien auf dem Gelände der enteigneten Kleinbrennereien zu errichten. So geschah es an der Südküste der Insel Islay, im tiefen Tal von Livet und allerorts in Schottland. Dieser lange wogende Kampf bildete den Firnis des Ölbilds „Kampf um das Fass“ von John Pettie (1839-93) und kam mir beim Betrachten in den Sinn.
Der Kampf jener Zeit, der in vielem einem Bürgerkrieg glich, gehört zu Schottlands geheimer Geschichte[1], über die man heutzutage aus falschem Stolz nicht gerne spricht. Hingegen wird am Stammtisch gerne eine Anekdote erzählt – die Geschichte vom Blue Trio; von John McKinlay und seiner Ehefrau Mary Blue, die zusammen mit Bruder Johnny als Schwarzbrenner am Ende des 19. Jahrhunderts Berühmtheit erlangten. Im Geiste von Robin Hood kämpfte das Blue Trio gegen die Obrigkeit und brannte schwarz zwei legendäre Whiskys – den „Taghell“ und den „Mondschein“. Beide Malts erlangten Berühmtheit aufgrund ihrer Fassstärke und Qualität, die weitaus besser als die Brände der legalen Brennereien gewesen sein mussten. Der Grund hierfür war gewiss, dass die beiden Whiskys weder gepanscht noch gestreckt waren, sondern einfach ehrliche Single Malts, gebrannt nach dem Ethos eines alten und auch wilden Gewerbes.
Um dem legendären Ruf des Blue Trios gerecht zu werden, seien neben dem Schwarzbrennen auch ihre Schmuggelkünste erwähnt. Ja, das Trio und seine Helfershelfer schmuggelten – und zwar mit Raffinesse. Berühmt wurde ihr Trick „Fass im Fass“. Wenn der Zoll zur Kontrolle den Fasskopf öffnete, entdeckte er Butter oder eingesalzene Heringe, aber die inneren Fassdeckel unter der deklarierten Ware, hinter denen sich der eigentliche Schatz verbarg, entdeckte er nicht. Gerne wird dieser Anekdote noch die pikante Note beigemischt, dass es sich beim verstorbenen US-Präsident Ronald Reagan um einen Nachkömmling mütterlicherseits der Blue Familie handelte.
Nicht nur in Fässern mit doppelten Köpfen, sondern auch in Särgen, in denen anstelle der Leiche 35 eingeschlagene Flaschen Whisky lagen, wurde geschmuggelt. Auch in Tornistern, in Dudelsäcken und in vorgetäuschten Schwangerschaftsbäuchen. Wohlgemerkt, lange vor dem Whiskyschmuggel in Särgen oder in Fässern wurde über das Meer holländischer Genever, spanischer Brandy, französischer Wein, Salz, Zucker und Tabak auf die britische Insel geschmuggelt, denn der Warenschmuggel ist so alt wie der Warenhandel selbst.
Wahrhaft abenteuerlich, vor allem aber heiß umkämpft, ging es in den alten Zeiten zu, ganz anders als in der Brennhalle, die ich nun mit einer buntgewürfelten Besuchergruppe betrat. Vor einem riesigen Panoramafenster standen sieben gewaltige Brennblasen unter Feuer und erzeugten eine schöne Wärme, aber keinerlei Lärm. Gleich musste ich an meinen Besuch bei Roseisle denken. Hier wie dort wurde mit minimaler Manpower gearbeitet, hier wie dort waren die Dimensionen nicht auf Liter, sondern auf Hektoliter ausgelegt. Einziger Unterschied: hier war es antiseptisch sauber, vom hell gestrichenen Betonboden hätte man essen können. Und die Stille in der Brennhalle glich der Stille in einem Gotteshaus.
Beim Rundgang stoppte unsere Tour vor dem spirit safe. Während der Guide, eine adrette Schottin mit brünetten Zöpfen, sein Funktionieren erklärte, wunderte ich mich über die Position des Messing-Glas-Kastens mitten im Raum ohne sichtbare Rohrverbindung zu den mächtigen Brennblasen. Nun ja, diese könnten auch unterirdisch verlegt sein, sagte ich mir. Aber als ich mir den glänzenden spirit safe aus der Nähe ansah, wies er nicht die leisesten Gebrauchsspuren auf. Warum tat sich in seinem Inneren nichts? Warum kein Zufluss des kristallklaren Brands? Nein, kein Rückfluss, einfach nichts an Leben im Inneren des Kastens! Als meine Gruppe weiterzog, trat ich ganz nahe an den blinkenden Kasten mit der zugeklappten Öffnung heran und entdeckte, dass es sich um eine Gerätschaft handelte, die funktionslos mitten im weiten Raum stand. Kurz musste ich überlegen, was diese Attrappe für einen Zweck erfüllen sollte. Schon kam mir die Erkenntnis, dass er nur noch die Nostalgie bedienen und dem ahnungslosen Besucher einen Prozess vorgaukeln sollte, den es bei The Glenlivet schon längst nicht mehr gab.
Inzwischen wurde auch hier der Brennprozess von einem Ingenieur in giftgrüner Neonweste überwacht, der erhöht hinter einem Schaltpult mit Kontrollinstrumenten saß. Sachlich präzise entschied allerdings nicht er, sondern ein Computerprogramm, wann der Kopf vom Herz und das Herz vom Schwanz des Destillats abgeschnitten und zurückgeführt oder behalten wurde. Damit ihm ja kein Besucher über die Schulter gucken konnte, war sein Terrain mit einer rotweißen Signalkette abgetrennt. Wie der Arbeiter so mutterseelenallein und separiert auf der Leitwache saß, tat er mir leid, weil er reglos wie ein Roboter vor diversen Monitoren und Lämpchen saß und diese überwachte – nicht mehr und nicht weniger. Die Reinheit des geistigen Getränks überwachte nicht mehr ein Mensch mit Augen, Nase und Gaumen, sondern ein programmierter Automat. Eine nüchterne Maschine hatte das Unberechenbare des menschlichen Tuns, zu dem Erfolg und Versagen gleichermaßen gehören, nahezu vollständig ersetzt. Das Fingerspitzengefühl eines altgedienten stillman war überflüssig geworden und ernsthaft fragte ich mich: wann würde auch die letzte Stunde dieses einsamen Kontrolleurs schlagen? Wann würde auch dieser Arbeitsplatz wegrationalisiert und durch die Korrektheit eines Algorithmus ersetzt?
Bricht auch beim Whiskymachen schon bald die Epoche des Dataismus an, wo Algorithmen allgemeine Regeln, womöglich gar Verkostungsnormen und Geschmacksparameter errechnen und kaum, dass man sich versieht, Aromen und Geschmäcker manipulieren? Wird womöglich schon in naher Zukunft von The Glenlivet und den anderen Großbrennereien das Trinkverhalten der weltweiten Whiskygemeinde erfasst und anhand von digitalen Hinterlassenschaften im Netz analysiert, um einen hippen und umsatzstarken Geschmackstrend zu kreieren und diesen dann wieder digital dem Einzelnen aufzuoktroyieren? Noch mögen diese Überlegungen ein Gedankenspiel sein, vielleicht auch Science-Fiction – nun ja, noch heute, aber in einigen Jahren? Welcher echte Whiskyfreund hätte vor 50 Jahren geglaubt, dass es der Kühlfiltration bedarf, die unter dem Begriff chill filtered zur gängigen Norm im Spirituosengewerbe geworden ist.
Ein gewisser William Muir erfand 1972 eine spezielle Filtermethode, um schwebende Ballaststoffe aus dem Holzfass und Fettsäuren, welche die Wolkenbildung, whisky haze, im eisgekühlten Drink verursachten, zu eliminieren. Seitdem es die Kältefiltration mit Hilfe von Kieselfiltern oder papierenen Schichtfiltern gibt, kann whisky on the rocks kristallklar, also kosmetisch bereinigt, im kurzen Tumbler auf Eiswürfeln getrunken werden. Diese amerikanische Art des Whiskytrinkens, kolportiert in jedem Hollywoodfilm, beherrscht auch in Schottland noch immer das Handwerk, weil die Giganten Diageo und Pernod Ricard hauptsächlich in die USA exportieren, wo auch der größte Absatzmarkt der Brennerei The Glenlivet liegt. Fairerweise muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass The Glenlivet den Nadurra anbietet, der non-chill filtered ist, also noch alle aromatischen Schwebeteilchen aus der Fassreifung, alle Holz- und Kohlepartikel, Proteine, Ester und langkettigen Fettsäuren enthält.
[1] Charles MacLean & Daniel MacCannell „Scotland’s Secret Historiy“, Edinburgh, 2017