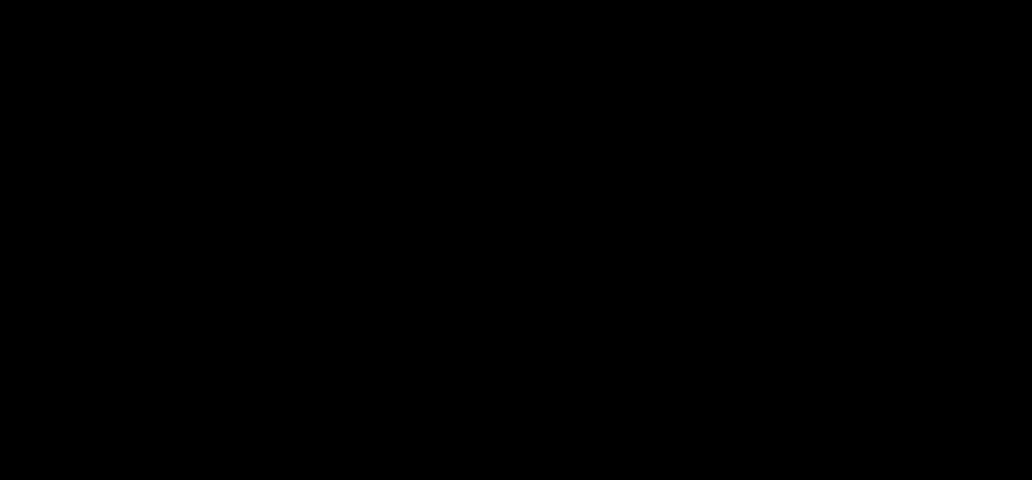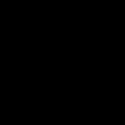Fast ein Jahr lang konnten wir Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen : Exklusiv auf Whiskyexerts präsentierten wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Nun, mit Folge 49, haben wir das Finale der Geschichte erreicht. Wir möchten uns bei Uli Franz für die Möglichkeit bedanken, unseren Lesern diese Geschichte präsentieren zu können – und bei unseren Lesern für die vielen freundlichen Zuschriften und Kommentare dazu.
Ab nächster Woche werden wir ein neues Feature für Ihre Sonntag-Vormittage bringen, zumindest einmal bis Weihnachten. Und auch 2022 werden wir Sie auch an den Sonntagen weiter mit interessantem Material für alle, die Whisky und seine Herkunfstländer lieben, versorgen. In diesem Sinne: Viel Vergnügen mit der letzten Folge.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 49)
Bei einbrechender Dunkelheit erreichte ich die Hafenstadt Dundee, die sich dem Design verschrieben hat. Design – ein anderes Wort für vollendete Form, weckt Erwartungen. Werden diese nicht erfüllt, ist man enttäuscht. Mehr als enttäuscht war ich, als das Chaos einer stillgelegten Hafenanlage meinen Endspurt ins Zentrum zur Slalomfahrt werden ließ. Gleich einem Kriegsschauplatz empfing mich ein Platz mit aufgerissenem Beton, stadteinwärts musste ich ihn queren, vorbei an stillgelegten Hafenschuppen, deren Wände als Malgrund für kindliches Kritzelkratzel und Sprühorgien dienten, auf keinen Fall für Kunstwerke der Street Art. Nach der Größe der verrottenden Schuppen und Kräne zu urteilen, pulsierte hier einst der Umschlag von Frachten auf Schiffe und Schiene in großem Stil.
Krater und Risse im Beton musste ich umfahren und in der Dämmerung höllisch auf scharfkantige Metallteile und Nägel achten. Im Slalom geübt, kurvte ich um rostige Container, zerbeulte Fässer, Stapel von Eisenträgern und Haufen aus Schrottblech herum. Sah so die Visitenkarte einer Stadt aus, die sich dem Design verschrieben hat? Ausrangiertes Eisen und Metall, Reminiszenz des verblichenen Industriezeitalters, lagen rostig seit ewigen Zeiten herum und wurden allein durch ihr Dasein zur Mahnung für das Heute, das Plastikzeitalter.
Bevor gar noch der Weltuntergang mein Oberstübchen erobern konnte, schob sich zum Glück ein technisch beeindruckendes Bauwerk vor den geputzten Abendhimmel – die schlanke Straßenbrücke Firth of Tay, die sich 40 Meter hoch über die zweitausend Meter breite Meerenge zwischen Dundee und Newport spannte. Diese Brücke auf ihren staksigen Stelzen fesselte meinen Blick und hinter der viktorianschen Hafenmeisterei konnte ich aufatmen. Locker platzierte Architektur aus nachhaltigen Materialien – Edelstahl, Naturstein und Holz – säumten den Kai und knapp dahinter lag wie ein ankerndes Schiff, das Designmuseum von Dundee, verkleidet mit hölzernen Streben, die dem Baukörper eine sphärische Luftigkeit verliehen.

In Museumsnähe fand ich ein Nachtquartier, das mir in Erinnerung blieb, weil es meine Ehrlichkeit auf die Probe stellte. In der Hektik des Aufbruchs am nächsten Morgen hatte ich den Zimmerschlüssel trotz einer festgebundenen, klobigen Holzkugel eingesteckt. Als ich Stunden später das Missgeschick bemerkte, schwankte ich kurz, sollte ich den Schlüssel achtlos wegwerfen oder zurückschicken? Ehrlich währt am längsten! An diesen Spruch aus dem Mund meines Vaters erinnerte ich mich und nahm ihn mir bewusst wieder zu Herzen. Ohne große Mühe überwand ich die Bequemlichkeit und sandte das fremde Eigentum in einem wattierten Umschlag zurück an die Pension.
Der Frühnebel über der Bucht von Dundee lichtete sich, als ich vom Meer wegkam und wieder in ein Auf und Ab aus Hügeln und Tälern hineinglitt. Mit wachsender Freude vertraute ich mich dem sanft gewellten Gelände an und stellte mir vor, wie die Gletscher der Eiszeit die Senken, durch die ich kam, über Millionen von Jahren in die Erdkruste frästen.
Es ging auf Mittag zu, da lenkte ich das Rad in den Dunst einer Senke hinab, die sich bis weit in den Horizont erstreckte. Schon bald schälte sich aus den feuchten Luftmassen ein dunkler See, in dem sich das Süßwasser des Tay und das Salzwasser der Nordsee molekularisch vermengten. Am verschilften Ufer von Firth of Tay radelte ich entlang, und bald war ich wieder im spielerischen Auf und Ab sanfter Hügel alleine. Ja, über Stunden war ich der einzige Erdenbürger weit und breit.
Menschenleere und Stille, nur selten vom Kronenrauschen alter Eichen, Eiben und Platanen gestört, sowie das Todholz umgestürzter Bäume ließen die Landschaft in einem urzeitlichen Gewand erscheinen. Als einsamer Radler wurde auch ich, ganz ohne mein Zutun, in dieses Tuch eingewoben, so dicht, dass es mir vorkam, als hätte ich Dundee und überhaupt die Zivilisation vor Jahren verlassen. In der Einsamkeit über Stunden nahm die Empfindung zu und verführte mich zum Sattelträumen – und plötzlich tauchten Ritter auf schweren Pferden, Marketenderwagen voller Marktfrauen und Kinder und marschierende Soldaten mit Lanzen und Schwertern vor meinem geistigen Auge auf. Ewig alt begegnete mir eine Landschaft, die sich laut Straßenschild noch immer „Kingdom of Fife“ nannte.
Die Landleute, die hier mit ihren Tieren in versteckten Cottages wohnten, sollen die glücklichsten Menschen von ganz Schottland sein, erzählten mir die Einheimischen von Hazelton Walls. Ihren Erzählungen glaubte ich sofort, zumal die Geschichte dieses unsagbare Glück belegt. Bereits im Frühmittelalter lockte die Wildnis von Firth of Tay die Einsiedler der Zisterzienser und Benediktiner hierher, wo sie die Klöster Balmerino und Dunfermline gründeten – auch die Lindores Abtei, wo ich nach meiner zeitvergessenen Fahrt gleich ankommen würde.
* * *
Der dreifach gezackte Giebel einer Fabrikhalle war rundum verglast. Von der Abtei Straße aus sah ich schon von weitem die drei Brennblasen, die kupferrot in der Sonne glühten. Nach der zeitvergessenen Passage durch das Land der Glücklichsten erreichte ich am späten Nachmittag wieder die moderne Geschäftigkeit, wie sie in jeder Destillerie herrscht. Nach acht Stunden Pedalarbeit traf ich in der Lindores Abbey Distillery von Newburgh ein.
Wie in Zeitlupe stieg ich vom Rad und augenblicklich freuten sich die Füße über die Erdberührung und den festen Stand am Boden. Viel Zeit ließ ich mir und langsam, meine Schritte setzend, schob ich mein Gefährt über einen kiesbelegten Hof, vorbei an der hohen Brennhalle und an einem flachen Gebäude aus hellem Stein entlang, den ein üppig verglaster Wandelgang säumte. Dort lehnte ich das Rad an eine Holzsäule des überkragenden Dachs und löste die Hände von den Lenkergriffen. Nicht nur dinghaft befreite ich meine Hände von den Griffen, sondern auch gedanklich befreite ich mich aus dem Modus des Radfahrens. Unendlich erleichtert atmete ich auf, dabei entwich ein befreiender Seufzer meiner Kehle. Mir wurde klar: ich habe es geschafft, ich bin am Ende meiner Tour zu siebzehn Destillerien angelangt, ich habe ein verwegenes Vorhaben in die Tat umgesetzt! Wahrlich ein Grund, sich zu freuen und einen Seufzer der Erleichterung in die Welt zu schicken.

Nach 1.400 Radkilometern hatte ich die siebzehnte und letzte aller besuchten Destillerien erreicht. Aber nein, nicht die letzte, sondern die erste! Mochte Lindores Abbey Distillery auf meiner Agenda die letzte Brennerei sein, in der Whiskygeschichte war sie die erste. Hier, an diesem historischen Ort, sprudelte zum ersten Mal vor fünfhundert Jahren der Quell von uisge beatha. Und kaum zu glauben: dieses Ereignis ist schwarz auf weiß belegt.
Mit Rußtinte und Federkiel notierte auf Pergament der Amtschreiber des königlichen Schatzamtes am 1. Juni 1494 die Anweisung: von König James IV. bekommt John Cor acht Bollen[1] Malz ausgehändigt, um aqua vitae herzustellen.
John Cor, der sich auch Johanni Kawe Cor nannte, war ein Mönch, der nach dem Ordensgelübde ora et labora lebte, was für ihn hieß, sowohl Gott zu dienen als auch der Pharmakologie. Bereits viele Jahre widmete er sich der Heilkunde, wofür er allerhand Meriten erhielt. Zu Weihnachten 1488, sechs Jahre vor der Ausgabe der acht Bollen Malz zum Destillieren von Lebenswasser, war er vom schottischen König für seine Dienste als Medikus seiner Majestät mit vierzehn Schillingen und einem schwarzen Gewand aus edelstem flanderischen Leinen belohnt worden. Das geschenkte schwarze Tuch trug er allerdings nur am Königshof zu Edinburgh. Kaum, dass er in sein Stammkloster Lindores zurückgekehrt war, tauschte er das schwarze gegen das steingraue Tuch, das Habit der tironensischen Mönche, die sich zum Orden des heiligen Benedikt von Nursia bekannten. Soweit die überlieferte Geschichte.
Nun war ich bekanntlich nicht als Pilger zur ehemaligen Abtei der Benediktiner geradelt, sondern um den Urquell von uisge beatha kennenzulernen und um natürlich auch das Erzeugnis der Lindores Destillerie zu probieren.
Im Visitors Center, wo man vom Fenster aus die Ruinen der Benediktiner Abtei vor Augen hat, traf ich den Manager von Lindores und im Gespräch saßen wir uns an einem Langtisch im nachgebauten Refektorium gegenüber – Gary Haggart, ein breitschultriger Schotte im schwarzen Poloshirt mit kupferfarbenem Logo auf der festen Brust, und ein Deutscher in schwarzer Radmontur. Eine Stahlrahmenbrille gab Gary Haggart’s gemütlichem Gesicht eine gewisse Strenge und ein Kurzhaarschnitt dem vollen Haar einen kantigen Halt. Obwohl sehr beschäftigt, nahm er sich Zeit für meine Fragen und im Gespräch wurde mir schnell klar, dass sich der leitende Manager gründlich mit der Geschichte der Lindores Abtei befasst hatte. Aber auch mit der schottischen Whiskygeschichte kannte er sich blendend aus.
„Es wäre grundfalsch oder zumindest naiv, beim damaligen Klosterbrand von Whisky zu sprechen“, stellte er gleich zu Beginn unserer Unterhaltung klar. „Was der Benediktinermönch John Cor aus Gerste destillierte, war ein hochprozentiger Korn, durchaus vergleichbar dem heutigen Doppelkorn, der ja auch zweimal gebrannt ist. Nüchtern betrachtet, war der damalige Brand so grob wie die Lebensumstände im Mittelalter eben waren. Die alten Niederschriften, die übrigens im Edinburgher Schloss aufbewahrt werden, belegen, dass John Cor die zugestandene Gerste von acht Bollen nicht destillierte, um sich oder seine Mönchsbrüder zu berauschen, sondern um Medizin herzustellen. Seine Arbeit mit dem Alkohol war also eindeutig auf die Gesundheit ausgerichtet. Mag sein, dass er beim Brennen mal ab und an ein Dram abgezweigt hat, aber ehrlich gesagt, das Gebräu muss schrecklich halskratzig geschmeckt haben.“ Gary Haggart lachte lauthals über seine eigenen Worte und der Adamsapfel unter seinem Doppelkinn hüpfte, als fände auch er Gefallen am Wörtchen „halskratzig“.
Mir gefiel die herzhafte, typisch schottische Heiterkeit und schon sah ich vor meinem geistigen Auge ihn als wohlgenährten Benediktinerabt im grauen Habit mir gegenüber sitzen.
Mit dem Zeigefinger tippte er auf die Tischplatte und berichtete nun sehr sachlich über seine Arbeit: „Wir forschen immer noch, weil wir vermuten, dass die Apothekermönche von damals mit Heilkräutern experimentierten, um ihr Destillat milder und weniger bitter hinzukriegen. Eins ist unumstößlich, ihr Klosterbrand mag noch so bitter geschmeckt haben, aber die Körpersäfte brachte er definitiv in Wallung und sorgte für die Heilung von vielen Krankheiten.“
Während er dies sagte, musste ich an meine Großmutter denken, die bei allen inneren und äußeren Leiden auf Klosterfrau Melissengeist schwor und gerne einige Tröpfchen auf einen weißen Würfel träufelte, um sich das Zückerchen mit Genuss auf die Zunge zu legen.
„Von Zeichnungen wissen wir, dass die Pharmakologen des Mittelalters einen kleinen Destillierhutzum Schnapsbrennen benutzten. Verglichen mit einer modernen Brennblase war der winzig und sehr primitiv, aber immerhin war er schon aus Kupfer. Was damals noch nicht erfunden war, das war die Reifung des Alkohols in Eichenfässern, die ja beim Whisky das A und O ist. Statt in Holzfässern wurde der frische Brand in Tonkrügen und Steintrögen aufbewahrt. Sie werden es nicht glauben, sogar in Schweinsblasen und in Schafmägen“, erzählte Manager Haggart und freute sich sichtlich, dass ihm jemand so gebannt zuhörte und sich auch noch Notizen machte. Seine geröteten Backen und die sprühenden braunen Augen hinter dem stählernen Brillengestell verrieten seine Freude über unser Zusammentreffen.
Erst jetzt deutete er mit dem Zeigefinger auf den Verschluss einer zimtbraunen Flasche, die schon die ganze Zeit zwischen uns auf der Tischplatte stand. Auf dem Etikett war im Relief ein Bär zu sehen, der auf den Hinterbeinen stand und mit den Tatzen einen Obstbaum schüttelte.
Schon die ganze Zeit brannte mir eine Frage zum Bären-Logo auf der Zunge. Da mein Gegenüber aber voller Feuereifer erzählte, wollte ich ihn nicht ausbremsen, sondern hörte ihm schweigend zu.
„Nun dürfen wir uns das Ganze nicht als rapide Entwicklung innerhalb von ein paar Jahren vorstellen. Ab dem urkundlich erwähnten Jahr 1494 vergingen sicher mehr als zweihundert Jahre bis ein mundendes Getränk gefunden war. Erst der sich in der Neuzeit entwickelnde Seehandel mit Indien und Arabien brachte Kräuter und Gewürze nach Schottland und schuf die Basis für unser Destillat.“

Nun endlich griff er zur bauchigen Flasche vor uns auf dem Refektoriumstisch und erklärte wieder ruhig und sachlich: „Was wir in unseren drei Brennblasen brennen, ist streng genommen kein Whisky. Zwar nehmen wir nur Gerste von den Feldern der örtlichen Farmer, denen auch die Destillerie gehört, aber den Rohbrand lassen wir nur sechs Monate im Stahltank reifen und geben dann Kräuter und Gewürze dazu. Dabei unterscheiden wir zwischen grünen und braunen Kräutern. Zu den grünen gehört Kardamom, Gänsekraut, Melisse und Minze. Zu den braunen Ingwer, Koriander, Gewürznelke und Sternanis. Aber mehr darf ich über unsere Ingredienzien nicht verraten…ist unser Betriebsgeheimnis!“ Mit einem Anflug von Verlegenheit, als sei ihm die Geheimnistuerei ein wenig peinlich, unterbrach er seine Ausführungen und schenkte mir schweigend einen Verkostungsschluck aus der zimtbraunen Flasche ein.
Likörsüße formte den Körper des vierzigprozentigen Aqua Vitae vom ersten Schnuppern bis zum letzten Schluck. Sofort erfassten Nase wie Gaumen die Spur fruchtiger Aromen von Apfel, Birne und Pflaume. Doch mit diesen Noten war der Früchtekorb noch längst nicht voll, hinten im Mundraum schmeckte ich noch die Süße von Zimt und Vanille. In seltener Harmonie und gleich auf Anhieb erspürten Nase und Gaumen im Lindores Lebenswasser den Kräuterlikör. Untrüglich handelte es sich um einen feinen Likör, der sich bestens als eisgekühlter Cocktail Basic eignet und deshalb in jedes Barfach gehört. Ja, darin bestand kein Zweifel! Aber Lindores Abbey Aqua Vitae ist streng genommen kein Whisky. Der klare Kräuterlikör wurde deshalb von mir auch nicht bewertet und meine Stützrad-Skala wandte ich auf diese artfremde Spirituose nicht an.
Mitten in der Verkostung bekam Gary Haggart einen Anruf auf sein Handy. Geschäftig wie es sich für einen Manager gehört, nahm er das Gespräch sofort entgegen. Kurz lauschte er und nickte verständnisvoll. Zu mir gewandt, entschuldigte er sich in knappen Worten, er müsse neue Gäste empfangen! Soeben sei ganz überraschend eine Gruppe Russen eingetroffen. Mit einer Schnelligkeit, die ich dem gemütlichen Mittfünfziger nicht zugetraut hätte, stand er vom Holztisch auf. Als er mir die Hand zum Abschied reichte, gab er mir noch einen Tipp: „Besuchen Sie unsere mittelalterliche Apotheke, gleich hinter dem Refektorium.“
Voller Erwartungen folgte ich dem Rat und stand ebenfalls von der Sitzbank auf. Mit schweren Beinen mühte ich mich an einem Langtisch vorbei in den nächsten Raum, wo eine Apotheke in mittelalterlichem Stil orginalgetreu nachgebaut worden war. Über einem grob gezimmerten Regal mit Tiegeln aus weißem Porzellan und einem großen Mörser für die Zubereitung von Drogen und Spezereien stand an der Wand ein lateinischer Spruch, eine Weisheit, die mich nach all dem Erlebten schmunzeln ließ, weil sie sich für den Genuss von Whisky, Whiskey und Lebenswässern aller Art vortrefflich eignet: „Man möge aqua vitae vor oder nach dem Essen einnehmen, außerdem zum Kochen, zur Handhygiene und zwischen den Mahlzeiten als Remedium gegen die Melancholie.“
Eher heiter als melancholisch trat ich wenig später aus der alten Apotheke ins Freie hinaus, wo mein bepacktes Rad noch immer an der Holzsäule lehnte als sei es von unserer Tour restlos fertig. Ich ließ es in Ruhe stehen und machte mich mit Bedacht an der linken Gepäcktasche zu schaffen. In ihr versteckte sich zwischen den Kleidern der Gegenstand eines Versprechens und den holte ich nun hervor. Dieses kleine Utensil führte ich seit Huntly, seit meinem Einkauf beim örtlichen Cost Cutter, mit im Gepäck. Es war die Miniatur eines VAT 69, die ich sorgsam wie mein Tagebuch, aber ungeöffnet, die ganze Strecke mitgeführt hatte. Erst am Ort, wo alles vor fünfhundert Jahren begann, wollte ich meinen Schicksalswhisky verkosten.
Wie ein Handschmeichler liegt das dunkelgrüne Fläschchen in meiner Rechten, als ich schweren Schritts die Abtei Straße überquere und durch ein offenes Eisentor zwischen Ruinen trete, zwischen die steinernen Überreste der Benediktiner Abtei von Lindores. Vom Zahn der Zeit zerfressen, vermutlich aber auch von Kämpfen weitgehend zerstört, ragen die Bogenreste eines Wandelgangs empor und lassen mich rätseln: war dies einst das gotische Kirchenportal? Auch in den verstreuten Steingefügen kann man nur mit Mühe Säulen erkennen, so dicht sind sie von einem Efeupelz überwuchert. Am knorrigen Stamm einer Eiche finde ich ein angemessenes Plätzchen im Gras. Klösterliche Stille ringsum, nicht mal ein Lüftchen streicht durch den Ruinengarten. Nun wird es Zeit, dass ich mich dem Mitbringsel aus Huntly widme.
Es knackt nur leise, als ich den Schraubverschluss mit einem leichten Ruck aufdrehe. Ich bin beruhigt, die Stille im ehemaligen Klostergarten habe ich nicht gestört. Kaum halte ich das geöffnete Fläschlein VAT 69 an die Nase, springt mich eine Note von geräuchertem Schinken und Leder an. Alles klar, ich halte einen getorften Whisky und keinen Kräuterlikör in der Hand! Diese Erkenntnis kann mich nach so vielen Verkostungen nicht mehr schrecken. Überrascht bin ich allerdings über das Wölkchen Frische, das sich naseweis in der medizinisch-bitteren Wolke tummelt. Kommt dieser Kitzel womöglich von der frischen Luft, an der ich sitze?
Couragiert nippe ich und schon schmeckt die Zunge Weichheit und Frucht und die Knospen registrieren erleichtert, dass sich Rauchschinken und Leder zügig verdünnisieren. Als ich die paar Tropfen kaue, kommt es mir vor, als beiße ich auf saftig grüne Blätter. Aber vermutlich ist auch dies nur Einbildung, weil ich den Scotch im Gras verkoste. Kurz züngelt ein böses Brennen im Schlund, aber nur kurz, schon erlischt der Brand und bündelt sich in wohliger Wärme. Ein zweiter Schluck grüsst wieder mit jener Rauchspecknote, die Freunde des Torfwhiskys so lieben. Längst ist mir klar: die herbe Note ist der Eintrittspreis für die Performance der Früchte.
Die Miniatur ist leergetrunken, genossen habe ich das Dram. Noch länger schlecke ich mir die Süße von den Lippen und spüre dem letzten fruchtigen Tropfen nach, während ich das grüne Fläschchen im Gras abstelle. Anhaltend grüssen Nachzügler von Fruchtnoten und füttern die Erinnerung an all die Tastings auf der Reise. Doch irgendwann sind auch die schönsten Aromen verflogen. Ich ziehe Bilanz und die fällt nüchtern aus: selbst bei angenehmer Süße verdient mein Jugendwhisky keine vier Stützräder.
Nun ja, das war auch nicht der Grund, warum ich ihn an diesem Ort, wo alles begann, verkostet habe. Ich nahm ihn mir nochmals zur Brust, weil mir die Aussöhnung am Herzen lag. Auch wenn er für meinen frühen Tod und die lange Abstinenz verantwortlich war, bleibt der VAT 69 doch der prägende Whisky meines Lebens.
* * * *
Anhang
Die 17 besuchten Brennereien in den Whiskyregionen
Lowlands
Auchentoshan
Lindores Abbey Distillery
Campbeltown
Springbank
Glen Scotia
Inseln
Islay
Laphroaig
Lagavulin
Ardbeg
Bruichladdich
Kilchoman
Arran
Lochranza
Highlands
Oban
Glen Garioch
Speyside
Roseisle
BenRiach
Glen Grant
Glenlivet
Glenallachie
Die 8 entdeckten perfect drams
Lagavulin, Bottler’s Edition Exclusive
Glenlivet, 21 y, Archives
Glen Grant, 170th Anniversary, 2010
Balvenie, Carribbean Cask, 14 y
Benromach, 10 y
Springbank, 15 y
Tobermory, 10 y
Old Pulteney, 12 y
[1] altschottisches Getreidehohlmaß entspricht 496 kg