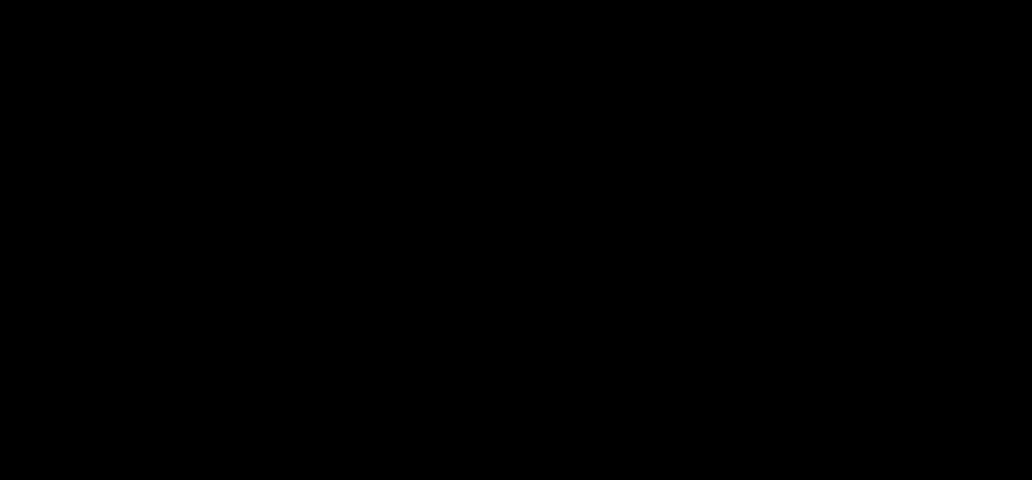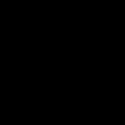Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 19)
Ein Geräusch von oben lenkte meine Aufmerksamkeit zum Dachgiebel hinauf und schon durchzuckte mich ein Schreck. Auf einer wackeligen Europalette stand ein Arbeiter, über und über mit weißer Farbe bekleckert, und strich ohne Seilsicherung, von einem mobilen Teleskoparm in die Höhe gehoben, die Giebelfront des Hauptgebäudes mit frischem Weiß. Wie ein Artist turnte er gut acht Meter über dem Boden unterhalb des Schriftzugs „Glen Scotia Distillery 1832“. Sein Hantieren mit der Farbrolle, die an einer Holzstange mit schwarzem Klebeband festgetapt war, sah so waghalsig aus, dass ich schon das Schlimmste befürchtete und schnell um die Ecke zurück in die Dalaruan Street lief.
Nach einigem Suchen fand ich den niedrigen Eingang zum Visitors Center, das sich als holzgetäfelte und urgemütliche Probierstube entpuppte. Wie in den Brennereien zuvor hatte man die alte Mälztenne zu Räumlichkeiten für Verkauf und Verkostung umgewidmet. Wieder einmal durfte ich erleben, dass Gäste aus Deutschland gerngesehene Gäste sind. Nun gut, ich war alleine gekommen und außer mir war kein anderer Besucher anwesend. Aber nicht nur bei Glen Scotia, sondern auf der gesamten Radtour sollte ich erleben, dass Deutschlands Image im Ausland viel besser als zuhause ist. So stand ich am Tresen als beliebter deutscher Gast und wurde hofiert. Mister Callum, ein verrenteter Vorarbeiter, der das kleine Center betreute, schenkte mir einen exklusiven Tropfen ein, einen 15jährigen Glen Scotia mit 63,5 % vol. Alkohol, dessen leuchtendes Bernstein viel Sanftmut vermuten ließ.
In der Nase lockten Zitrusfrüchte, die sich wie bei einer Schichttorte cremig über eine vanillige Eichennote legten und einen federleichten Pfirsichduft verströmten. Der Strauß an Aromen hätte nicht harmonischer duften können. Am Gaumen erlebte ich gleich einen Reigen aus Rosinen, Feigen und Karamell. Erstaunlich – fruchtige Aromen und malzige Holznuancen lagen sich harmonisch in den Armen. Leider war diese Umarmung zu flüchtig, ihre Verbindung hielt nur kurz und hatte keinen Bestand. Schlimmer noch, es folgte eine echte Enttäuschung: eine Holzkeule zertrümmerte im Schlund und in der Speiseröhre die anfängliche Begeisterung und hinterließ im Abgang ein unversöhnliches Brennen in der Kehle. Nach einem zweiten Schluck lautete das Resümee: Antritt faszinierend frisch, doch im Abgang viel, viel trockenes Holz und herbes Kratzen. Bei bestem Willen, ich konnte dem exklusiven Glen Scotia nicht mehr als drei Stützräder geben.
Höflich bedankte ich mich bei Mr. Callum, dem Pensionär, der Springbank und Glen Scotia gleichermaßen kannte, und trat durch die niedrige Tür auf den nassen Gehweg hinaus.
Neugierig, ob der Maler noch durch die Lüfte turnte, schaute ich wieder um die Ecke. Zum Glück hatte sich der Artist wider Willen verzogen, die Farbrolle und der Eimer standen allerdings noch verkleckert am Boden herum. Irgendwie lockte mich die Unordnung an und ich entschloss mich, den Innenhof zu erkunden. Das Tor des Lagerhauses stand offen und aus dem düsteren Inneren strömte der Duft der Engel, deren Odeur mich schon wieder beschwipste. Fässer über Fässer, sechs Regale hoch, stapelten sich im fensterlosen Raum bis knapp unter das dunkel verschattete Dach. Vor dem offenen Tor ratschten seelenruhig zwei Arbeiter mit dem Gabelstaplerfahrer, der gerade die Umschichtung einer Fässerreihe beendet hatte. Wieder mal auf Gälisch erklärte der Fahrer mir, dass die untere Lage nach oben rotieren müsste und die obere nach unten, damit der Whisky in unterschiedlichen Klimazonen reifen konnte. Im ersten Moment erschien mir diese Hoch-Tief-Aktion übertrieben, doch als ich den Kopf in den Nacken legte und hinaufsah, eröffnete sich mir der Sinn der Massnahme, denn das Blechdach wurde im Sommer sehr heiß und im Winter kalt, während die Kiesschüttung des Hallenbodens in der heißen Jahreszeit und im Winter kühl blieb.

Gerade als ich das Gelände verlassen wollte, pirschte der Gabelstapler an die Pritsche eines eingefahrenen Lasters heran und fing sofort an, Paletten mit graubraunen, nicht mehr neuen Fässern abzuladen. Auf den Fassköpfen der angelieferten Ware stand eingebrannt das Insignium: Beam, USA. Das Brandmal bewies, dass es sich bei der eingetroffenen Ladung um frisch aus den Staaten importierte Ex-Bourbonfässer handelte. Hätte ich mich nicht ausgekannt, ich hätte verächtlich die Nase gerümpft: gebrauchte Fässer, graubraun, dreckig und fleckig und durch die Bank unansehnlich anzuschauen! Doch diese Geringschätzung wäre fehl am Platz gewesen, denn die Karamell-Note der gebrauchten Fässer bildet das geschmackliche Rückgrat eines Single Malt. Seit 1940 ist es gang und gäbe, dass ein new make zur ersten, mehrjährigen Reifung in ein Ex-Bourbonfass gegeben wird, denn das Einmaleins lautet: gebrauchte Bourbonfässer aus nordamerikanischer Weißeiche verpassen ihm jene begehrte Note von Karamell und Vanille, während jungfräuliche Weißeiche eine holzige Note mit Röstaromen liefert.
Den Tesco-Supermarkt passierend, schlenderte ich die Esplanade entlang wieder in Richtung Zentrum. Das Meer an meiner Seite gehorchte dem Rhythmus von Ebbe und Flut und in den Stunden des Nachmittags warf es weit draußen Wellen. Das befestigte Ufer roch süßlich nach Algen und salzigem Tang. Niedlich anzuschauen, die großen graugrünen Krebse, zwischen den bemoosten Steinen huschten sie aus Angst vor den Möwen von Deckung zu Deckung.
Auch in mir zog sich etwas zurück und schürte Verlassensängste. Es war jenes wehmütige Gefühl, das jeder beim Abschied von einem liebgewordenen Menschen oder einem vertrauten Ort kennt. Schon bald musste ich einem Ort den Rücken kehren, wo ich viel erfahren hatte – viele technische und handwerkliche Kniffe des Vorbereitens, Destillierens und des Fassmanagements. Im verregneten Campbeltown hatte ich ein Plätzlein gefunden und gelernt, dass das Erzeugen einer vergnüglichen und komfortablen Spirituose ein ehrwürdiges Traditionshandwerk war, ein Handwerk, das sich aus harter Hand- und Maschinenarbeit speiste.

Schaukelt ein Whisky, egal ob Single Malt, Blend oder Bourbon, bernsteinfarben und verheißungsvoll im Glas, ist es nur schwerlich vorstellbar, wieviele Schweißtropfen und Handgriffe und dann Geduld, Geduld und nochmals Geduld es kostet, bis das perfekte Dram zum Trinken angerichtet ist. In den beiden Campbeltowner Regentagen dämmerte mir, dass Trinkgewohnheiten eine kulturelle Angelegenheit sind und dass genau deshalb die Geduld eine ehrbare Ingredienz des Whiskys ist. Nicht umsonst kursiert unter Kennern der Spruch „Geduld ist keine Eigenschaft, sondern eine Zutat“.
Zu Beginn meines Whiskyunterrichts hatte ich mich noch in deutscher Manier gefragt, warum sind die Schotten solche Langweiler? Warum sind sie so einfältig und warten eine halbe Ewigkeit, bis sie den richtigen Trinkmoment für gekommen erachten? Warum halten sie es nicht wie wir Deutschen, wie die Polen oder die Russen und zwitschern den Korn oder Wodka gleich nach der Destillation? Langsam, ganz allmählich glaubte ich, das Geheimnis der Schotten, eben die Geduld, gelüftet zu haben. In diesem Sinn war Campbeltown zu einem Sesam-öffne-dich geworden.
Zum Abschluss meines Besuchs in Schottlands südlichster Whiskystadt gönnte ich mir nach einem Fischdinner noch einen Drink in der Hafenkneipe Bilbannam.
Kaum, dass ich durch die Schwingtür in die gerammelt volle Schankstube trat, sprangen mich von der Bar und von den vorderen Tischplätzen her strenge Blicke an, als wäre ich ein stadtbekannter Zechpreller. Augenblicklich schmolz der Schneid des Soloradlers dahin und vor lauter Verlegenheit wusste ich plötzlich nicht mehr, was ich inmitten all der Männer, der abgeheuerten alten Matrosen, der Destilleriearbeiter, der Automechaniker und der Bauarbeiter hier wollte. Gezwungen lächelnd nickte ich der glotzenden Gemeinschaft zu und stellte mich an einen freien Platz am langen Tresen. Der kurz abgeebbte Lärm gab mir ein wenig Zeit, um mich umzusehen. Die meisten Männer im schlecht belüfteten, von Zigarettenrauch geschwängerten Schankraum trugen karierte Flanellhemden über gewaltigen Bäuchen, die in blauen und schwarzen Arbeitshosen steckten. Urig wie man sie von Seebären kennt, sahen alle wettergegerbten, bartlosen oder bärtigen Gesichter aus und mittendrin kam ich mir vor wie ein frischgeschlüpftes Küken. Doch dann entdeckte ich ein zweites Küken im überhitzten Raum, ein ungemein kindlich wirkendes zartes Mädchen mit einem käsig bleichen, runden Gesicht unter rotbraunen Haaren, das als Barfrau die Gäste an der Theke und an den Tischen bediente. Das bleiche Kind wirkte zerbrechlich und irgendwie kränklich, so als käme es nie an die frische Luft. Wie ich bei ihr ein Draft bestellte, fiel mein Blick auf das Flaschenregal in ihrem Rücken.
Oh Wunder, da stand zum Greifen nahe inmitten vieler angebrochener und auch halbleerer Spirituosen mein Schicksalswhisky, die schwarzgrüne Flasche mit der großen weißen Zahl – der VAT 69. Aufgeregt zeigte ich mit ausgestrecktem Arm auf die Flasche und bat das zarte Barmädchen: „Bitte, von dem ein Dram“.

Verwundert sah sie mich an, gar befremdet, als behauptete ich, ihr Vater zu sein. Kurz angebunden sagte sie: „Die ist leer!“
„Was für ein Pech“, antwortete ich, „wo krieg ich davon eine Flasche her?“
„Weiß ich doch nicht!“
Eine solch knappe Antwort sollte ich noch öfters erhalten, sobald ich auf der weiteren Reise nach etwas Ausgefallenem und Nichtalltäglichem verlangte.
Da stand ich nun an der Theke und wusste nicht so recht, sollte ich als nächstes die VAT 69-Fährte aufnehmen oder die Suche ans Ende meiner Radtour vertagen? Schließlich entschied ich mich für das Hier und Jetzt und ließ mir von dem schrecklich bleichen Thekenkind ein blondes Belhaven zapfen. Mit einem großen Schluck wurde ich Teil der urigen Gemeinschaft, weil ich tat, was alle hier taten: Bier aus großen Gläsern trinken. Während um mich herum wieder lärmend auf Gälisch palavert wurde, stellte ich fest, dass alle vor sich Gläser mit Ale oder einem Blond stehen hatten. Keiner gönnte sich einen Kornwhisky oder gar einen teuren Single Malt. Überhaupt war mir inzwischen klar geworden, dass in Schottland im Vergleich zur Massenfertigung herzlich wenig Whisky getrunken wurde.
Wie hatten sich doch die Zeiten seit den achtziger Jahren verändert! Wieviel zahmer und genügsamer waren die Schotten geworden! Noch vor vierzig Jahren wurde zu Silvester und Neujahr zuhause in der Familie und im Pub versöhnlich mit den Nachbarn bis zum Umfallen gepichelt. Und nicht nur zwischen den Jahren, sondern zu jeder Jahreszeit kreiste der Flachmann im Freien, beim Fischen oder Jagen oder unter den Wanderkameraden.
Dass sich kein Einheimischer zu mir gesellte und mich in ein Gespräch einband, gramte mich nicht. Das Alleinsein an der Stehtheke nutzte ich zum Bilanzieren. Obwohl es die beiden letzten Tage nur geregnet hatte, war mein Stimmungsbarometer nie unter Null gefallen, vielmehr hatte mich stets eine leichte Wohlfühlbrise umweht. Bei Springbank und in den Gesprächen mit den Adepten der Whisky Schule hatte ich so viel Grundwissen über das Whiskymachen erhalten, dass ich mich ab jetzt in einer Runde von Connaisseurs nicht mehr zu verstecken brauchte. Nun war der richtige Moment gekommen, am südlichsten Punkt meiner Radreise umzukehren und die Fahrt nach Norden anzutreten. Mit dem Auto wäre das ein Klacks von fünf Stunden Fahrt gewesen – aber mit dem Fahrrad? Wie lange würde die Fahrt nach Inverness wohl dauern? Noch hatte ich nur eine vage Vision, aber keinen Fahrplan.
(Fortsetzung folgt)