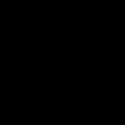Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 32)
Die Tartan Wahl
„Was ist eigentlich Whisky?“, fragte mich Gordon, der Bartender, und machte eine Miene wie ein Quizmaster vor großem Publikum. Ohne mir Zeit zum Nachdenken zu lassen, platzte er auch gleich mit der Antwort heraus: „Der Geschlechtsakt zwischen Herrn Alkohol und Frau Eiche. Okay, die Spießer reden um den heißen Brei herum.“ Mit abfälliger Handbewegung ergänzte er: „Verklemmt wie sie sind, vermeiden sie das Wort Geschlechtsakt und sagen dafür gestelzt ‚Vermählung von Alkohol und Eiche‘.“
„Aha!“ Mehr als verdutztes Erstaunen brachte ich nicht über die Lippen, denn hinter dem Tresen stand ein erheblich jüngerer Mann, dem ich glatt eine Doktorarbeit über Whisky zugetraut hätte, nicht aber eine so abwertende, vor allem aber so simple und auch noch provokante Definition des Wesens von Whisky. Mein Gegenüber mochte um die fünfunddreißig sein, smart, schlank und hoch gewachsen, ein durchaus stattliches Exemplar von Mann. Aber wie mir schien, war er nicht durchtrainiert und sportlich fit. Dagegen sprach seine Gesichtsfarbe, die wächsern und nicht gerade von Frischluft durchlüftet schien. Der feine Spott, der sein Lächeln formte, deutete auf eine gewisse Überheblichkeit hin. Vermutlich liebte dieser junge Mann hinter der Bartheke aus Gewohnheit zu sticheln. Wer weiß, womöglich war mein Eindruck auch falsch, womöglich sah er in mir nur ein versprengtes Individuum aus dem Touristenschwarm, der in der Highland Metropole Inverness einfällt, kaum dass der Startschuss zur Saison ertönt. Womöglich, so überlegte ich, hatte er mir nur aus Jux eine Fangfrage gestellt, vielleicht auch nur, um mit einem neuen Gast ins Gespräch zu kommen.
Die Autorität seines Auftretens rührte auf keinen Fall von seinem Outfit her. Nichts, aber auch gar nichts, hatte sein Äußeres mit der eleganten Erscheinung eines Charles Schumann mit tadellos geplätteter, weißer Langschürze und schwarzer Weste auf weißem, seidendurchwirkten Hemd zu tun. Bartender Gordon stand in Slim-fit-Jeans, marineblauem, offenen Hemd und mausgrauem Blouson hinter der Theke. Nun, es waren seine Stimme, sein Blick und sein Barbestand, die eine Autorität verströmten, wie sie mir schon öfters bei 30- bis 40jährigen Whiskyenthusiasten begegnet war. Im ersten Moment unterschätzt man diese sehr lässig, beinahe schnoddrig gekleideten jungen Männer mit Dreitagebart. Doch kaum, dass sie ein Dram in der Hand halten, entzündet sich in ihren Augen, ihrer Mimik und auf ihren Lippen ein Feuerwerk des Wissens. Gordon gehörte zu dieser Sorte von Kennern und schnell wurde mir klar, er liebte nicht nur Whisky, nein, er lebte Whisky.
Nach längerem Umherirren in den Altstadtgassen am Victorian Market hatte ich endlich das Messingschild „The Malt Room“ an einer eisernen Haustür entdeckt. Das minimalistische Schild war der einzige Hinweis auf die kleine Bar im Herzen von Inverness, die ihrem Namen voll und ganz gerecht wurde. Der Bewirtungsraum, den ich durch einen winzigen, schlecht beleuchteten Flur betrat, war schummrig beleuchtet, im wesentlichen bestrahlt durch Spots an der Wand hinter vielen durchscheinenden Whiskyflaschen. Er bestand nur aus der Schanktheke mit der verspiegelten Flaschenwand dahinter und einer Sitznische. Eigentlich ein besseres Wohnzimmer, das war mein Eindruck beim ersten Besuch und entsprechend taufte ich die Location im Herzen von Inverness: „Gordon’s Minibar“.
Die Bar mochte noch so winzig sein, aber sie offenbarte Gordon’s Philosophie: reduziert bis aufs Äußerste das Maximale zelebrieren. Auf den Glasböden an der Barwand standen die feinsten Single Malts und Blends aus Schottland, aber auch aus Irland, Japan, Deutschland und Bourbons aus den USA. Eine wahrhaft erlesene Kollektion! Jahrelang musste er gespart und rare, inzwischen vergriffene Whiskys gesammelt haben, die er nun täglich hinter dem Tresen stehend, als Dram oder als Flights zu ambitionieren Preisen verkaufte.
Auf selbstgezimmerten Holzbrettchen konnte man zwischen vier Flights mit jeweils drei Drams wählen. „Modest Flights“ war das Einsteigergedeck, „Memorable Flights“ das Gedeck für Fortgeschrittene, darüber hinaus gab es ein „Chocolate Flights“, vorzugsweise für Damen, und „Magnificant Flights“, das Gedeck zum Abheben. Für umgerechnet 270 Euro servierte Gordon die exquisitesten Gaumenfreuden und eine kurze Erklärung dazu: „Hier links haben wir einen Macallan, 25 Jahre, in der Mitte einen Dalmore, ebenfalls 25 Jahre, und rechts einen Laphroaig mit 25 Jahren Fassreifung.“
Noch immer stand ich unschlüssig vor der gewaltigen Auswahl und überlegte, welches die richtige Wahl sein könnte. Noch immer dachte ich über Gordon’s Worte nach und fragte mich, was meinem Gemüt unter diesen Umständen wirklich gut tun würde? Mein Blick streifte das vergitterte Fenster und als ich nach draußen sah, benetzte noch immer feiner Sprühregen das Gassenplaster und rann in schwärzlichen Schlieren die Hauswände hinab. Menschen unter Schirmen liefen vorbei und nahmen mir die Entscheidung ab, nach draußen zu gehen. Als wenig später ein Pärchen trotz Regen den „Malt Room“ verließ, wechselte ich vom Barhocker auf das abgewetzte Ledersofa in der Nische und bestellte – leider nein, kein Edelgedeck vom ranghöchsten Glasboden, sondern meinem Budget entsprechend einen Hirschgeweih-Whisky, einen Dalmore[1].
Über Dalmore hatte ich schon viel gelesen und gehört, denn diese 1839 gegründete und nördlich von Inverness gelegene Destillerie, die heute zum philippinischen Brandy-Konzern Emperador gehört, ist unwiderruflich mit dem Namen Richard Paterson verbunden. Jeder Connaisseur zwischen New York und Tokio kennt diesen Namen, und alle Eingeweihten kennen die Arbeitskleidung dieses berühmten Master Blenders: pechschwarzer Anzug, stilisiert zu höchster Akkuratesse mit seidenem Einstecktuch und silbern changierender Krawatte. Seine gewiss hochversicherte und nicht gerade bescheidene Nase, unter der ein Schnäuzer einen dauerhaften Akzent im fein geröteten Gesicht setzt, hat sich im Laufe eines Lebens in hunderttausende Nosing Gläser versenkt, um das perfekte Dram zu kreieren – was ihm auch vielfach gelang, wie zahlreiche Prämierungen belegen.
Meine Wahl war auf einen Dalmore gefallen, weil ich nämlich keine Stunde zuvor einen spannenden Fund in Leakey’s Book Shop gemacht hatte. In diesem Antiquariat, etabliert in einer ehemaligen Kirche, war mir die Autobiographie „Goodness Nose“ von ebendiesem Richard Paterson und Gavin S.Smith in die Hände gefallen, und second hand hatte ich sie günstig erworben. Das reichbebilderte Buch lag nun als Beiwerk neben dem Dalmore Dram auf dem Sofatischchen und sein Großformat forderte mich während der Verkostung zum Durchblättern auf.
Pfefferbraun stand der Zwölfjährige im Glas, was verwunderte, denn in seiner alkoholischen Dichte wirkte er nicht gerade sehr ölig. Ohne sein Alter zu kennen, hätte ich ihn nach der Farbprüfung für einen Achtzehnjährigen gehalten. Ob er wohl Farbstoff enthielt, fragte ich mich und auch Gordon, der mir beim Verkosten zusah, während er Gläser spülte.
„Kann schon sein, bei uns braucht man diesen Zusatz nicht auf dem Etikett zu vermerken.“
„In Deutschland muss der Begriff ‚Zuckerkulör‘ auf dem Etikett stehen“, erwiderte ich und ergriff das kleine Glas am Bauch, um es an die Nase zu führen. Aromatisch schmeichelhaft waren gleich Vanille und Zimt auszumachen, aber genauso schnell wurden die süßen Töne von Noten aus Malz und Leder verdrängt, und rasch gewann das Erdige die Oberhand. Vielversprechend – der erste Kontakt, ja, so einladend, dass ich gleich nochmals schnuppern musste. Derweil fragte ich mich: wie mochte sich wohl die Blume am Gaumen entfalten?
Die erste Zungenbegegnung ließ sofort viel Speichel einschießen, obwohl die Fassstärke auf 40 % vol. verringert worden war, und füllte den Mundraum mit einer gehörigen Portion Schokolade, einer mit viel herbem Kakao. Vor mir sah ich einen ganzen Kakaobaum, wie er fett braun seine Früchte trug, aber wie ich den Dalmore zu kauen begann, verkehrte sich der Kakaogeschmack in eine seifige Note, die schleimig den hinteren Gaumen belegte, was einen schalen Eindruck hinterließ, den man zugegeben auch als Milde hätte auslegen können.
Nach dem ersten Schluck stand fest: das Vorspiel in der Nase hatte mehr Vergnügen als die Schmeckbegegnung gebracht. Und das, was schließlich im Schlund ankam, war nur noch ein Hauch von Orange und Rosine, weil die Eiche den Abgang von A bis Z bestimmte. Beim zweiten Schluck zeigte sich der Nachhall gar bitter – und was mir noch bei keiner Verkostung untergekommen war – die Zungenspitze wurde pelzig. Im Mundraum setzte sich außerdem ein bitter-adstringierender Geschmack durch wie man ihn von bissigen Tanninen im Rotwein kennt. Sorry, Master Paterson! Leider verbarg ihr zwölfjähriges Kind doch zuviel Bitterkeit unter seinem süßen Mäntelchen, was in der Konsequenz zu einer Bewertung mit zwei Stützrädern führte.
Wie hingeworfen lag auf dem Bartresen das schlanke Buch „Bad Whisky“ von Edward Burns und wirkte mit dem Totenkopf auf dem Titel ebenso provokant wie Gordon’s Geschlechtsakt-Vergleich. Der Dalmore hatte meine Zunge gelockert, so deutete ich auf das Buch und fragte Gordon, der immer noch hinter der Bar für Ordnung sorgte: „Hast du das mit dem Geschlechtsakt da draus?“
„Ach was, glaubst du wirklich, das habe ich ernst gemeint“, sagte er grinsend, „das sagte ich doch nur so zum Spaß. Na ja, ein wahrer Kern ist schon dran. Aber du musst wissen, so verklemmt sind wir Schotten auch wieder nicht. Jetzt aber ernsthaft: was darf ich dir auf Kosten des Hauses zum Probieren anbieten?“
Mein Blick schweifte über das Flaschenheer, das durch die Wandspots in den schönsten Malt-Tönen erstrahlte. Ein vielschichtiges Gold und ein warmes Bernstein schmeichelten dem Blick und ich ließ mir Zeit, die Etiketten zu studieren. Da sie von hinten angestrahlt wurden, waren sie leider alle verschattet und ich musste mich über die Theke nach vorne beugen. Am Rand eines höheren Glasbodens entdeckte mein suchender Blick zwei geliebte Japaner: Hibiki 17 years und Hakushu 12 years. Spontan wollte ich einen der beiden Edlen wählen. Doch schnell kam der Gedanke auf, es wäre doch einfallslos, einem alten Bekannten meine Aufwartung zu machen. Viel verheißungsvoller wäre es, einen Unbekannten kennenzulernen.
Also tat ich, was alle Whiskykundler tun, wenn sie eine Fährte aufnehmen: sie studieren ausgiebig die Etiketten. Etiketten sind mehr als eyecatcher, sie sind kleine Enzyklopädien, die oftmals Geheimnisse in sich bergen! Nicht ohne Grund tüfteln ganze Werbeagenturen am Erscheinungsbild von Labels und suchen meist lange und kostenintensiv nach einem gefälligen oder ausgefallenen Image für das Produkt. Das Posterbuch „The Art of Whisky“ fiel mir ein, diese nostalgische Bilderreise, die mehr als tausend Worte über die Menschen und ihre Trinkkultur von anno dazumal offenbarte.
Mein Etikettenstudium zeitigte schließlich ein Resultat, das mich selbst erstaunte. Ein schmales Etikett, kaum mehr als eine Banderole, das dem flüssigen Gold hinter Glas viel Raum ließ, fand mein Wohlgefallen. Die Flasche wirkte edel, denn am Bauch trug sie die Prägung 1798.
Gordon, der während meines Studiums noch immer mit Gläserpolieren beschäftigt war, schenkte das Dram mit der Erläuterung ein: „Gute Wahl, der Ledaig. Er reifte achtzehn Jahre und bringt 46,3 % vol. ins Glas. Sein Finish hat er in Sherry-Batches erhalten. Er ist getorft, deshalb leicht rauchig und kommt aus der Brennerei Tobermory auf der Insel Mull. Wohl bekomm’s!“
„Oh ja, Tobermory kenne ich bereits, ich habe den Zehnjährigen verkostet, der war perfekt, allerdings ungetorft.“
Das indirekte Licht in Gordon’s Minibar taugte nicht wirklich zur Bewertung der Goldnuancen im Glas, deshalb legte ich viel Wert auf die Öligkeit des Ledaig. Mehrmals ließ ich ihn kreiseln, wodurch er in flüssigen Fäden und Tropfen an der Glaswand hinunter rann, was meinen Kennerblick beruhigte. Ja, hier stimmten Dichte und Jahresangabe überein. Gleich beim ersten Schnuppern kletterten Aromen süßlich bis süß hinauf ins Nasendach. An diese Wolke von Karamell hatte eine erdige Torfnote angedockt. Als ich mit dem linken, dem sensibleren Nasenloch schnüffelte, gesellte sich noch eine frische Kühle hinzu. Der erste Schluck startete mit einem leichten Brizzeln an der Zungenspitze, gefolgt von einer schönen Ladung Vanille und holziger Süße. Im Finish kulminierte das alkoholische Brizzeln in einer Welle von Malz und bitterem Rauch. Diese Welle nahm gegen Ende überhand und machte es meiner Zunge schwer, die süßen und würzigen Früchte der Sherry-Eiche herauszuschmecken. Schade, wirklich schade, diese Ernüchterung nach dem verheißungsvollen Kitzeln in der Ouvertüre. Insgesamt gesehen fehlte dem Ledaig, von dem das Dram umgerechnet 11,50 Euro kostete, der Spannungsbogen: ein Bogen, der in der Nase seinen ersten und in der Magengrube seinen Abschlusstreffer landet. Vor allem im Abgang fehlte ihm das Komplexe eines fülligen Körpers. Anstatt vier Stützräder wie sein jüngerer, ungetorfter Bruder erzielte der um acht Jahre ältere nur drei.
Schuld am Verlust eines Rads war im wesentlichen der malzlastige Abgang. Gewiss, der Ledaig hatte meine Gunst gewonnen. Aber für vier Stützräder war seine Mundgravur einfach zu blass, und beim Abschied fehlte der herzhafte Händedruck, die Berührung einer Hand, die man gerne für länger gehalten hätte.
Zum Ende meines Besuchs in Gordon’s Minibar erwartete mich noch eine Denkaufgabe auf der Winztoilette, wo über dem Pinkelbecken das Spruchtäfelchen hing: „If whisky goes in, wisdom comes out!“ Was mochte der tiefere Sinn dieses Klospruchs sein? Beim Lesen verwirrte mich diese „Weisheit“ mehr als sie mir erklärte. Erst nach längerem Überlegen interpretierte ich den Spruch so: im Resultat siegt die Erkenntnis, dass man etwas Gescheites zu sich genommen haben muss, damit was Gescheites rauskommt.
(Fortsetzung folgt)
[1] dal-moor