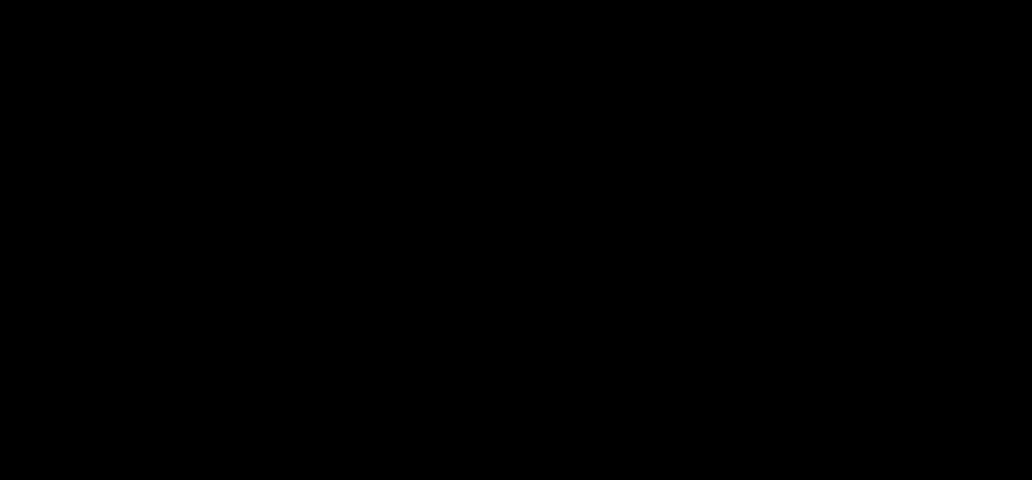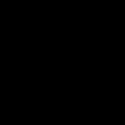Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv im Vorabdruck präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) erscheint am 01.02.2021 im Alba Collection Verlag GbR. Es kann bis zum 20.01.2021 zum Einführungspreis (Subskriptionspreis) von 16,- Euro hier vorbestellt werden.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 6)
Als ich in einem großen aufwärts führenden Bogen den Abschied von der Bucht anging, musste ich immer wieder zurückschauen. Der Blick über die weite Niederung war so einmalig, dass ich ihn unbedingt abspeichern musste. Eine derart stimmig in die Küstenlandschaft eingebettete Destillerie sollte mir in den kommenden Wochen nur noch einmal begegnen, und wenn ich Ardbeg mit Auchentoshan[1] verglich, dann sah ich hier die reinste Idylle. Auchentoshan, meine erstbesuchte Brennerei, lag nämlich dicht an der lärmenden Autobahn im Glasgower Vorort Clydebank.
Die „überlebte“ Verkostung eines getorften Malts hatte meiner Skepsis einen Knuff verpasst und kurzentschlossen steuerte ich auf der Rückfahrt nach Port Ellen die Brennerei Lagavulin[2] an.
Der Himmel über Islay konnte einem Radler nicht wohlgesonnener sein, überhaupt war er seit meiner Ankunft in Edinburgh Anfang Mai überaus gnädig gewesen. Als ich vor sechs Tagen von dort losgeradelt war, musste ich meinen Anorak nur für einige Stunden überziehen. Wenn mich auf Islay etwas behinderte, dann nicht der Regen, sondern ein böiger und überaus launischer Wind, der mir ins Gesicht schlug, gleich darauf aber drehte und mir in den Rücken fiel, was bekanntlich eine schöne Sache und gar nicht hinterhältig ist. Wie ich nun zur dritten Islay-Brennerei unterwegs war, galoppierte er vom atlantischen Horizont herein, als wolle er mich ins Grün einer weitgefächerten Weidelandschaft drängen.
Nach Verlassen der Ardbeg Bucht bewegte ich mich für längere Zeit dicht an pockennarbigen und grauschwarz verwitterten, vor Jahrhunderten trocken aufgeschichteten Steinmauern entlang und kam an äsenden Mutterschafen mit Lämmern vorbei. In gemächlichem Tempo hielt ich Zwiesprache mit den weißen Wollknäueln dicht hinter der Mauer, die vor drei Monaten weißfellige Kinder geboren hatten. Kehlig rief ich „mäh, määh, määääh“ und schnalzte mit der Zunge. Kurz hoben sie die langen Köpfe mit den Schlappohren, guckten den nahen Menschen erschrocken an, senken dann aber gleich wieder ihre rosigen Schnauzen, um die sprießenden Halme zu schnabulieren. Wochen später, auf der Fahrt durch die Highlands, sollten mir noch Tausende und Abertausende ihrer Artgenossen begegnen und von einem Schafhirten erfuhr ich, dass ihre Allwetterwolle zu Dumping Preisen nach China und ihr festes Muskelfleisch in die muslimischen Länder verkauft wird.
Nach zwanzig Minuten Treten in einem mittleren Gang, was mich den Schluck Ardbeg rasch ausschwitzen ließ, bog ich auf den Parkplatz von Lagavulin ein. Diese dritte Brennerei an der Südküste der Insel könnte der kleine Bruder von Laphroaig sein, so ähneln sich ihr Antlitz und ihr Standort. Beide liegen unmittelbar am Ufer einer Bucht, wo es bei der Ankunft wieder nach Salz, Algen und Seetang roch, denn der Atlantik zeigte immer noch Ebbe. Über dem kalkweiß getünchten Puzzle aus Lagerhäusern, Mälzhalle und Brennhaus stand eine Wolke aus Mostgerüchen wie über einer bayerischen Brauerei. Hätte nicht der verräterische Geruch die Gebäude umwabert, man hätte in ihnen eine x-beliebige Fabrikanlage vermuten können, so nahe am Wasser gewiss auch eine Werft für den Schiffsbau.

Nachdem ich umgerechnet zehn Euro bezahlt hatte, durfte ich an einer Gruppenführung durch das Herzstück der Destillerie mit anschließender Verkostung teilnehmen. Auf der halbstündigen Führung beeindruckte die hohe Halle mit den zehn hölzernen Maischbottichen aus Oregon Pinie. Diese zehn wash backs waren so gewaltig, dass mir bei ihrem Anblick ein Faszinosum aus meiner Kindheit in den Sinn kam.
Auf der Kirmes gab es noch in den fünfziger und sechziger Jahren das Motodrom, in dem Motorradfahrer unter Höllenlärm und Abgaswolken die hölzernen Steilwände auf einem Rundkurs befuhren und, für mich als kleinen Jungen unbegreiflich, selbst aus großer Höhe nicht zu Boden fielen. An dieses haushohe, runde Steilwandgebilde aus gefügten Holzdielen musste ich denken, als ich jetzt die wash backs bei Lagavulin erblickte. Dabei stand unsere Gruppe nicht am Boden, sondern auf verzinktem Gitterstahl, der als Empore um die Bottiche gebaut und nur über eine Gittertreppe zu erklimmen war.
„Was schätzen Sie, wieviele Liter haben da drin Platz?“ Unser Guide, eine junge Schottin mit breitem Gesicht voller Sommersprossen und brünettem Haar, das dichtgeflochten in Zöpfen auf ihren Schultern lag, schaute in die Runde. Wir alle schwiegen wie ertappt, derweil wir ernsthaft überlegten. Endlich wagte eine blonde Frau in schrill-pinkem Sportanorak zu schätzen und rief gegen den Maschinenlärm ankämpfend in den Raum: „Ich würde schätzen, 10.000 Liter!“
Unser Guide schüttelte den Kopf, nicht rechthaberisch, nur wissend: „Nein, viel mehr! Knapp das Vierfache, 38.000 Liter. Schauen Sie durch den Rost, auf dem wir stehen, wie weit die wash backs in die Tiefe reichen. Wir stehen hier sechs Meter über dem Boden. Und der Durchmesser eines Bottichs beträgt nochmals fünf.“
Noch nie zuvor hatte ich solch einen gewaltigen, aus Holzbohlen gefügten Bottich erblicken und auch noch anfassen dürfen. „38.000 Liter Fassungsvermögen!“ notierte ich beeindruckt ins Tagebuch.
Wir gruppierten uns um eine Luke im hölzernen Bottichdeckel und einer nach dem anderen durfte den eckigen Lukendeckel anheben und seine Nase ins Innere stecken. Als mir die Ausdünstungen, die dem blubbernden, mostbraunen Bläschenmeer entstiegen, in die Nase schossen, sprang mich augenblicklich die geballte Kraft der alkoholischen Gärung an. Diese Ausdünstungen, die auch abgemildert durch die hohe Halle waberten, waren alles andere als ein Nasenschmeichler. Sie detonierten als Duftbombe aus fruchtigem Most, aber auch als Gestank von Durchfall und bitterer Stammwürze.
Das Mädchen mit den Zöpfen erklärte nun das Geschehen im Maischbottich: „Der Malzbrei sieht aus wie Porridge, allerdings schmeckt er noch fader als Haferschleim. Nun ja, er ist ja noch im Werden. Auf jeden Fall wird er mit heißem Wasser aufgegossen und zu einer Würze eingedickt, wodurch die enthaltene Stärke durch die Arbeit der Enzyme in Malzzucker umgewandelt wird. Das Ziel der mehrmaligen heißen Wässerung ist es, alle vergärbaren Zuckeranteile aus dem Brei herauszulösen. Schließlich wird eine letzte Wasserfüllung mit nahezu kochendem Wasser vorgenommen. Diese dritte, recht wässrige Suppe bleibt dann im Bottich zurück und dient als Ausgangsmaterial für die neue Befüllung…können Sie mir soweit folgen?“, fragte sie und blickte uns der Reihe nach an. Niemand sagte ein Wort, auch nicht die vermeintliche Amerikanerin im schrillen Anorak, aber alle nickten und bekundeten stumm ihre Wissbegier.

Die junge Schottin war gewiss zum Guide ausgebildet worden, sie machte ihren Job sehr gut und konzentrierte sich auf das Wesentliche: „Also, nun der nächste Arbeitsschritt! Durch den perforierten Boden des Holzbottichs, der wie ein Sieb wirkt, wird die Würze von den Feststoffen der gemahlenen Gerste, was vor allem Spelzen sind, abgetrennt und gesammelt. Diese Würze fließt durch einen Wärmetauscher und gelangt“, unser Guide zeigte mit ausgestrecktem Arm nach oben, „durch das Rohrsystem an der Hallendecke in die Brennblasen in der angeschlossenen Brennhalle. Die ausgewaschenen Spelzen werden keinesfalls weggeworfen, denn sie enthalten immer noch wertvolle Mineralien, Proteine und vitaminreiche Ballaststoffe. Deshalb werden sie getrocknet und an die Bauern der Umgebung als Nahrungsergänzungsmittel für das Vieh verkauft.“
Sie verzog keine Miene, als sie „Nahrungsergänzungsmittel“ in den Mund nahm, aber ich erspähte ein Zwinkern ihres linken Auges, als wollte sie ganz beiläufig den Gesundheitsaposteln eins auswischen. Wieder spitzte sie die zart geschminkten Lippen und fuhr fort: „Soweit also die vorausgegangene Verarbeitung der Gerste. Nun zum Prozess im zweiten Bottich, ich will ihn auch erklären. Also, hier drin wird im ersten Schritt die über das Rohrsystem aus dem Nebengebäude eingeleitete Zuckerlösung bis auf 20° Celsius abgekühlt. Erst bei dieser niedrigen Temperatur können die Hefepilze für die Gärung zugesetzt werden. Wäre der Brei heißer, würde die Hefe absterben und die Gärung würde unterbleiben…“
„Bitte erklären Sie uns auch, was es mit der Hefe auf sich hat“, wollte ein älterer Herr mit Schweizer Akzent wissen, der in einem fort fotografierte und ebenfalls alle Ausführungen notierte.
Die junge Schottin nickte, vermutlich wurde diese Frage nach der Hefe öfters gestellt, und antwortete: „Wir verwenden eine industriell gefertigte Trockenhefe. Sie müssen wissen, Hefe ist ein Pilz, also etwas Essbares, das weder tierisch noch pflanzlich ist. Finden die Hefezellen, die in die Milliarden gehen, ein passendes Milieu aus Wärme, Mineralien und Proteinen vor, beginnen sie zu knospen und vermehren sich rasch. Man unterscheidet zwischen Wildhefe und Zuchthefe, aber bei Lagavulin wird nur noch getrocknete und industriell gefertigte Zuchthefe verwendet, die wir einkaufen. Um 30.000 Liter Würze zu fermentieren braucht man 100 kg Trockenhefe, erst dann kann die Verwandlung von Zucker in Alkohol beginnen.“
„Für mich riecht es hier wie in einer Bierbrauerei“, warf ein Besucher aus der hinteren Reihe ein.
„Ja, wenn es hier wie in einer Brauerei süßlich-sauer riecht, darf das keinen verwundern, denn der schäumende Brei ist tatsächlich Bier, allerdings ohne den Zusatz von Hopfen. Deshalb benutzen wir auch nicht das Wort beer sondern sprechen von wash. Wer will, kann nun nochmals einen Blick ins Innere werfen.“ Ruckartig hob sie erneut den Lukendeckel in die Höhe, drehte den Kopf zur Seite, so abrupt, als hätte ihr Nebenmann einen Gewaltigen ziehen lassen. Mit ausgestrecktem Arm zeigte sie auf den wabernden, mostbraunen Brei: „Die Dauer der Gärung bestimmt den Geschmack und die Würzigkeit des wash, der bekanntlich das Ausgangsprodukt für die Destillation ist. Bei der Gärung ist es genauso wie bei der Kaffeeröstung. Je schneller eine Röstung durchgepeitscht wird, einfach um eine große Menge Röstkaffee mit möglichst geringem technischen Aufwand zu bekommen, desto nichtssagender, ja auch bitterer, werden die braunen Bohnen im Geschmack. Bei uns dauert die Gärung um die 100 Stunden. Wir setzen also auf Gründlichkeit, weil dies Einfluss auf die spätere Qualität des Whiskys hat. Während der vier Tage und Nächte dauernden, sanften Gärung wandeln die Hefestämme den Zucker in Alkohol um…Können Sie mir noch folgen? Ist ja nicht so ganz einfach die Materie…“

„Wie im Chemieunterricht“, rief der Herr mit dem Schweizer Akzent dazwischen und alle lachten herzhaft über den kleinen Scherz.
Auch die Schottin musste lachen, vergass aber keine Sekunde ihre Aufgabe als engagierte Gruppenleiterin. „Also wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei der Gärung. Also dabei geht es nicht so ganz reinlich zu. Durch Fäulnisbakterien entsteht Kohlendioxid, was farblos und im Gegensatz zum Butangas geruchlos ist und von unseren Nasen nicht wahrgenommen wird. Das ist also nicht ungefährlich, deshalb muss während der Gärung immer für Frischluft gesorgt werden. Bei Lagavulin wird das Gas abgesaut und über Rohre ins Freie geleitet. Wenn die Gärung abgeschlossen ist, hat das hopfenlose, nussig schmeckende Bier einen Alkoholgehalt von 8 – 9 % vol. und kann über ein Rohrsystem den Brennblasen im nächsten Gebäude zugeführt werden.“
„Ich hätte noch eine Frage zur Fermention: Wie verhindert man, dass der wash überkocht?“, wollte die pinke Dame wissen, die ich aufgrund ihres Zungenschlags für eine Besucherin aus dem Land des Bourbon hielt.
„Ja, das ist in der Tat eine wichtige Frage. Ein Braumeister muss immer wachsam sein, dass das blubbernde und in Blasen wabbernde Bier nicht überschäumt und bei der hohen Temperatur von 80 Grad C nicht überkocht.“ Sie machte eine kleine Verschnaufpause und schloss währenddessen das Lukenfenster vor uns. „Früher haben die Braumeister ein Stück Kernseife in den Bottich geworfen, um das Bier zu zähmen. Heutzutage haben die wash backs oben einen großen, waagrecht laufenden Propeller, der den Schaum immer wieder klein schlägt. Wie Sie sehen können, sind die Luken mit gut verschließbaren Deckeln versehen, damit aus der Hallenluft keine Essigbakterien eindringen können und damit auch der Gärschaum nicht herausquillt. Allerdings auch wegen des gefährlichen Kohlendioxids, was ja in hoher Konzentration die Aufnahme von Sauerstoff verhindert. Wohlgemerkt, man riecht das Gas ja nicht, deshalb ist es so gefährlich. So, wer will, kann jetzt noch den Finger in den Brei dippen.“ Wie sie das sagte, öffnete sie nochmals die Luke und lud uns mit ausladender Handbewegung der Reihe nach ein, eine Fingerprobe zu nehmen.
Nahezu jeder der Gruppe folgte der Aufforderung, auch ich, und zu meinem Erstaunen schmeckte der Brei wie ein warmer Bananen-Shake, erstaunlich süß und cremig nussig.
(Fortsetzung folgt)