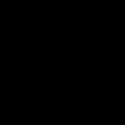Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 20)
Von Loch zu Loch
Campbeltown machte dem drängenden Cyclisten den Abschied schwer, vermutlich weil die Kleinstadt meine heimliche Zuneigung verspürte. Ja, ich musste mich losreissen, um von hier wegzukommen.
Unmittelbar hinter der Uferpromenade, die sich wie ein Kummerbund um den Bauch der Bucht schlang, stieg die Ausfallstraße an und zwang mich schon früh, kraftvoll in die Pedale zu steigen. Was Anstiege in den Highlands angeht, muss man wissen, dass sie in der Regel wie diese am Ortsausgang von Campbeltown nur auf einigen hundert Metern steil, selten auch extrem steil, angelegt sind.
Die zwölf Kilogramm Gepäck in den randvollen Satteltaschen bremsten das Vorwärtskommen und bereits nach einigen hundert Steigungsmetern hämmerte der Puls und schlug mir bis zum Hals. Schon schnaufte ich wie ein alter Gaul und kurz darauf hörte ich mich hecheln wie ein Wetthund. Offen gestanden, stöhnte ich auch ein paarmal ziemlich erbärmlich, lagen doch zwei Tagen der Radentwöhnung hinter mir.
Froh war ich trotzdem, denn gleich würde es mit dem dauernden Frösteln und Bibbern während der beiden Regentage vorbei sein. Ist eine Steigung auf 12 oder gar 14 % angelegt, dann wird einem gleich warm, aber gleichzeitig bricht auch der Schweiß aus allen Poren hervor, wenn man einen Anorak mit verschweißten Nähten anhat, durch dessen Membran die Haut nur ungenügend atmen kann. Noch während ich mich abmühte, stand der Entschluss fest, mich am höchsten Punkt als erstes aus der Gore-Tex-Klamotte zu pellen. Gesagt, getan! Doch dafür musste ich anhalten und absteigen.
Von oben eröffnete sich ein Rundblick über saftig grüne Hügelweiden und eine graugrüne Bucht, an deren inneren Rändern eine Granitstadt gewachsen war – und zwar über den gewaltigen Zeitraum von vierhundert Jahren. Aus der Ferne harmonierte das urbane Ensemble mit der Natur, verträumt ruhte es zwischen den Hügeln. Aus höherer Warte wirkte Campbeltown entrückt und ungemein friedlich. Nach den Minuten des Schauens verflog die Sentimentalität des Abschieds und Dankbarkeit flutete mein Herz. Immerhin war ich an diesem alten Ort nochmals „zur Schule gegangen“ – und zwar ohne Zwang. Jetzt befand sich das Gelernte in meinem geistigen Gepäck.
Schon lockerte der Himmel über Kintyre sein düsteres Grau, und die flauschige Wolkendecke öffnete hie und da eine Luke zum Licht. Nachdem der Anorak verstaut war und mit ihm die Erinnerung, hielt ich mich nicht länger auf, sondern stieg erneut in den Sattel und fuhr leichten Herzens meinem nächsten Ziel, dem Fischerhafen Carradale, entgegen.
Die Halbinsel Kintyre ist eine einzige Abfolge von Berg- und Talfahrten, von denen sich die kürzeste nicht länger als eine weitgefächerte Kurve und die längste nicht länger als tausend Meter zieht. Diese topographische Form ist heute nur noch für die Spezies der Radfahrer wichtig. Allerdings war sie bis ins Jahr 2003 auch für die große Masse, gar für die englische Gesellschaft von Bedeutung – und zwar im Hinblick auf Moral, Sitte und Anstand. Bis 2003 beherrschte der sogenannte Mull-of Kintyre-Test den Index der britischen Filmzensur. Nacktszenen auf Zelluloid waren zwar erlaubt, aber auf der Leinwand durfte der männliche Penis keinen größeren Winkel zur Senkrechten bilden als die Halbinsel Kintyre zum schottischen Festland. Ein Blick auf die Landkarte beweist die verblüffende Ähnlichkeit der langen Halbinsel mit einem schlaff herabhängenden Glied samt großer Eichel und schnell wird jedem Kartenbetrachter klar, dass die geographische Form das genaue Gegenteil einer Erektion darstellt.
Keine Erektion, aber eine gewisse Erregung überkam mich, als ich vor dem Wind das erste Gefälle hinab zischte, während meine Gedanken bereits in die Highlands voraus eilten. Beim Summen der Reifen und lockeren Pendeln der Beine kam ich mir vor wie an einem Geburtstag mit reichlich Geschenken. Die Geschenke, die ich erwarten durfte, trugen bedeutende Namen: Oban, Fort William, Loch Ness, Glen Affric, Inverness.
Irgendwann rollte das Fahrrad aus und gleich darauf tauchte ein rotweißes Verkehrsschild mit der Zahl 16 % vor mir auf. Sechzehn Prozent sind heftig, zumal mit Gepäck. Ohne falschen Ehrgeiz stieg ich ab und schob das beladene Rad bergauf. Wie sich schnell herausstellen sollte, brauchte ich nur zweihundert Meter zu gehen, denn länger als eine ausladende Kurve stemmte sich diese Steigung nicht in den Himmel. Nachdem ich gut zehn Kilometer im Auf- und Abmodus gefahren war, hatte ich die Gewissheit, dass sich die B 842 auf ganzer Länge als Sträßlein, nein, eher als asphaltierter Weg, nicht breiter als eine Fahrradlänge, die Ostküste entlang hangeln würde. Für den entgegenkommenden Verkehr waren Ausweichbuchten alle fünfhundert Meter eingerichtet. Da so gut wie kein Auto unterwegs war und sich das Wetter stündlich besserte, freute ich mich bald wie ein Kind auf seinem Kinderrädchen.
Die B 842 verlief als Arteriole der langgestreckten Halbinsel Kintyre nahe am Ostufer und in Sichtweite des Atlantiks, der auf den Seekarten Irische See genannt wird. Mal erklomm das Asphaltband bastbraune Hänge, mal wand es sich abwärts durch wuchernde Waldstücke und wagte sich sogar an die weiße Bordüre von Sandstränden heran. Meine flotte Fahrt durch eingezäunte Weiden wurde wieder einmal von tausenden Mutterschafen und ihren frischgeborenen Lämmern begleitet, die sich allerdings mehr für das junge Gras des Frühsommers als für den leisen Radler interessieren.
Als ich das Örtchen Torrisdale Castle durchfuhr, schob sich am Horizont zu meiner Rechten ein massiger Erdkegel, kahl und graubraun wie ein altes Ziegenfell, ins Bild. Vom Kartenstudium wusste ich, dass dieser Klotz die Insel Arran mit ihrem Gipfel Goat Fell war. Im Fahren musste ich immer wieder zu dem kargen Eiland hinüberlinsen, ob sich dort drüben Gebäude oder wenigstens geduckte Katen, überhaupt menschliches Leben, entdecken ließen. Aber jenseits der Meerenge tat sich nichts, so blieb ich allein mit meinem Gefährt. Mit der Zeit bildete ich mir in dieser Menschenleere ein, ich wäre ein Alexander von Humboldt auf Expeditionsreise, weil ich mich so einsam durch eine urzeitliche Landschaft bewegte, deren Hügel aus Gneiss vor 300 Millionen Jahren unter Eisströmen und Gletschern ihre wellige und gestaffelte Form gefunden hatten. Alexander von Humboldt! Gleich musste ich laut lachen über die Anmaßung meiner flüchtigen Gedanken während der locker driftenden Fahrt auf der autofreien Trasse.
Als gegen Mittag ein kleiner Lieferwagen auf mich zufuhr, drosselte der Fahrer seine Fahrt voller Respekt, vielleicht sogar voller Erstaunen, und winkte mir beim Passieren freundlich durch die schmierige Frontscheibe zu. So sollte es mir mit wenigen Ausnahmen auf meiner gesamten Radtour ergehen: der motorisierte Verkehr behandelte den Radfahrer meistens zuvorkommend und geduldig. Darüber habe ich viel nachgedacht und mich oftmals gefragt: warum funktioniert das nicht auch auf deutschen Straßen: außerorts, vor allem aber innerorts?
Geduld ist eben mehr als eine Tugend, Geduld ist eine Errungenschaft der Kultur, ein Traditionsbewusstein, das die Schotten immer noch pflegen, indem sie die Zeitsouveränität ihrer Urväter und Urmütter leben. Mull of Kintyre nordwärts radelnd, sagte ich mir, dass dieser Menschenschlag auch heute noch mit der Natur und ihren Zyklen vernabelt ist, viel stärker als wir vom Kontinent dies sind und gar zu träumen wagen.
Mit jeder pedalierten Meile wuchs mein Misstrauen in den Himmel. Unruhig spähte ich immer wieder in die Türme, Haufen, Walzen und riesigen Kissen tiefhängender Wolken hinauf. Würde es gleich schütten, so grauschwarz wie die Wolkendecke über mir waberte? Schneller trat ich in die Pedale – bloß nicht wieder in einen Starkregen wie auf Islay geraten.
Zum Glück begleitete mich ein verständnisvoller Kamerad, der Wind, der die Regenwolken aufs Meer hinaustrieb und wieder einmal durfte ich erleben, dass in Schottland selbst der schwärzeste Himmel nicht zwingend Gewitter und Regen bringt. Im Weiterkommen wurde aus einem tintenschwarzen ein graphitgraues Wolkendach und schon tauchten schwarzweiße, schwarze und weiße Vögel aus heiterer Höhe auf. Laut krächzend und kreischend, aber auch lautlos, schossen Elstern in Pärchen, Krähen und Möwen in Scharen durch den aufklarenden Luftraum über mir. Vermutlich würde ich schon bald auf eine Menschensiedlung treffen, deren Abfälle die Vogelschwärme anlockten.
Kurz vor der Abzweigung nach Carradale grüssten gelbblühende, sich bauschende Ginstersträucher und ich hätte schwören können, durch einen Blumengarten zu radeln. Beim Passieren der ersten Cottages und eines verlassenen, ruinösen Hotels am Ortseingang, zeigte sich schon wieder die Sonne und massierte mir wärmend den Rücken. Verwundert stellte ich fest, dass sie längst den Zenit überschritten hatte und hinter den roten Backsteinhäusern schwarze, verschoben lange Hausformen auf den Boden malte. Für die Strecke von 24 Kilometern hatte ich bei mässiger Fahrt und vier Trinkpausen doch sechs Stunden gebraucht, so hügelig hatte sich das löchrige Asphaltband die Küste entlang gehangelt.
In den gehegten Vorgärten der Fischerhäuser blühten rosarote und weiße Tulpen, Päonien und über der Pracht lag der Duft von Rosen. Sogar einen rosa blühenden Magnolienbaum entdeckte ich in der Obhut einer Hausmauer. Wieder einmal erlebte ich die wärmende Kraft des Golfstroms, der selbst Stechpalmen hier überwintern lässt. Die üppigste Gartenschau lockte vor einem Backsteinhaus, vermutlich der ehemaligen Dorfschule. Am Gußeisenzaun entdeckte ich beim langsamen Vorbeifahren das Schild B&B.
Mit schweren Beinen stieg ich ab, lehnte das Rad an den Zaun und öffnete ein quietschendes Gartentörchen, das angelehnt jedem Besucher offenstand. Im Garten begrüsste mich lange vor der Wirtin der Duft von Rosen und Pfingstrosen und aufgebrochenen roten und gelben Tulpen. Nach den zurückliegenden Fahrstunden an bastbraunen Hängen entlang, war ich überwältigt von dieser Blumenkultur und fragte mich instinktiv: wäre ein Single Malt Flores Caledonia, der den Duft schottischer Rosen, Päonien und Tulpen in die Nase bringt, nicht eine Innovation? Auch ein Gin gleichen Namens wäre denkbar. Erschöpft von der Berg- und Talfahrt ließ ich mich auf eine verwitterte Gartenbank plumpsen und trank vom Blumennektar als sei er ein Café frappé.
Vermutlich hatten die Hausbewohner längst den Fremden durch die gehäkelte Gardine erspäht, denn plötzlich ging die Haustür auf und eine blonde Frau in einem aufreizend engen Pulli stöckelte die Treppe herunter auf mich zu. Ihr blondes Haar schmiegte sich onduliert um ihr weiches Gesicht, in dem kecke braune Augen mit roten Lippen um die Wette lockten. Die attraktive Frau, die um die fünfunddreißig sein mochte, gehörte nicht zu der Sorte Schottinnen, deren Arme bis zu den Schultern hinauf tätowiert waren und deren schrill gefärbte Frisur als Rattenschwänzchen mit einem Gummiband im Nacken festgetrimmt war. Von wegen, diese Blondine war auch nicht in gothic schwarz gekleidet und schob auch keine schwabbelige Wampe vor sich her. Gut, sie war nicht gerade dünn, aber das Feste um die Leibesmitte zeugte von viel Gemüse, nicht aber von einer Fritten oder Burger lastigen Ernährung. Sie hatte das Erscheinungsbild einer blonden Skandinavierin. Auch eine Polin hätte sie sein können, noch eher als eine Schottin.
Sie lächelte als hätte sie meine Gedanken erraten und sagte in lustigem Volksschulenglisch: „Willkommen verehrter Herr, schön, dass Sie hierher gefunden haben, Sie suchen gewiss eine Unterkunft für die Nacht.“
Beim Ausfüllen des Meldeformulars sollte ich erfahren, dass sie und ihr Mann aus Litauen stammten. Gemeinsam waren sie als junge Leute vor fünfzehn Jahren nach London ausgewandert. Als ihnen vor vier Jahren die Metropole zu teuer wurde, verließen sie die Stadt und erwarben das Haus an der Dorfstraße von Carradale.
Ohne lange zu handeln, wurden wir uns schnell einig – sie genehmigte mir einen Vorsaison-Rabatt und ich bezog ihr Romantikzimmer. Die lindgrüne Blümchen-Tapete und die Gardinen mit den verschlungenen Lilien sowie der Teppichboden mit den langflorigen Sonnenblumen erzählten von einer großen Sehnsucht. Auch die zehn Plüsch- und Knuddelkissen, die sich auf dem französischen Bett türmten, ließen vermuten, dass die Besitzerin zu gerne als Prinzessin zur Welt gekommen wäre.
Um den einstigen Salon auf das Niveau eines B&B Fremdenzimmers zu heben, war in einer Zimmerecke eine Duschkabine samt Waschbecken und Kloschüssel installiert worden, eine Investition, die natürlich den Preis hob, dafür aber dem Bettplatz viel von seiner Großzügigkeit raubte. Enge am Bett hin oder her, jetzt war erst einmal eine Dusche gefragt. Eine heiße Dusche ist immer das Höchste der Gefühle nach einem langen Radtag.
Kaum war die Wirtin aus der Tür, trat ich nackt in die weiße Astronautenkapsel und ruckelte hinter mir die klemmende Kabinentür zu. Von Zuhause den Komfort einer durchdachten Mischbatterie für kaltes und warmes Wasser gewohnt, wollte ich, ohne lange nachzudenken, Warmwasser aus dem Brausekopf zapfen. Zugegeben, die Armatur in ihrer Bauchigkeit kam mir schon etwas seltsam vor. Als ich nun am blaumarkierten Wasserhahn drehte, passierte nichts, kein Tröpfchen Wasser wagte sich aus dem Brausekopf. Auch tat sich nichts, als ich den Hahn mit der roten Markierung gegen den Uhrzeigersinn drehte. Nackt und fröstelnd stand ich vor einem Gerät an der weißen Kabinenwand, das ich noch nie in meinem ganzen Traveller-Leben gesehen, geschweige denn bedient hatte. Als ich immer nervöser an der Armatur mit ihren zwei Hähnen und zwei Drehknöpfen hantierte, dämmerte mir, dass es sich um einen Durchlauferhitzer handeln musste, der nur mit Strom funktionierte.
Ärger stieg in mir hoch, Ärger über mich, weil ich mal wieder die Gebrauchsanleitung nicht gelesen hatte. Diese hing schwarz auf weiß außen an der Kabinenwand. Also ruckelte ich die klemmende Tür wieder auf und stieg nackt und inzwischen bibbernd vor Kälte aus der Plastikkapsel. Endlich hatte ich die Lesebrille aus dem Gepäck gekramt und konnte die vier Piktogramme erkennen. Aha! Als allererstes müsste ich den großen Schalter neben der Zimmertür umlegen. Diese simple Aufforderung prägte ich mir ein und lief frierend über den Sonnenblumenflor zum Hauptschalter für die Zimmerelektrik. Kaum machte es unter meinem Zeigefinger „klack“, gingen an der Armatur ein rotes Lämpchen und am Bett ein Schirmlämpchen an. Auch eine vorsintflutliche Heizspirale über der Kloschüssel fing an, sich von grau in orange zu verfärben. Hastig lief ich zurück, schloss mit kräftigem Ruck die klemmende Kabinentür hinter mir und drückte auf einen schwarzen Knopf, wie es die Anleitung verlangte. Sofort ratterte das Wandgerät ohrenbetäubend los und spuckte eiskaltes Wasser aus der Überkopfbrause. Im Reflex drehte ich an einem Regler mit roten Temperaturzahlen, um das Wasser im Durchlauferhitzer auf Körperwärme zu regulieren. Uff, geschafft! Der Wasserstrahl aus der Kopfbrause erwärmte sich tatsächlich. Wie angenehm! Was für eine Ingenieursleistung!
Doch auf einmal, als wollte sich die Armatur für mein Unvermögen revanchieren, wurde aus handwarm abrupt siedend heiß! Mit einem Seitwärtssprung wich ich dem dampfenden Wasserstrahl aus und drehte hektisch an der Scheibe, um mir nicht Kopf und Schultern zu verbrühen. Das bauchige Gerät ratterte und pumpte wie wild, weil sein abgekapseltes Innenleben nicht nur eine Heizschlange für das Warmwasser enthielt, sondern auch einen Kompressor, um das kalte und warme Wasser mit Druck aus der Brause sprühen zu lassen.
Schließlich fand ich doch noch die Balance zwischen angenehm und unerträglich temperiert und endlich ergoss sich ein sparsamer, aber immerhin warmer Strahl über meinen Scheitel. Ich gab mich trotzdem zufrieden und nahm mir vor, die nächsten Duschabenteuer klüger anzugehen. Bereits in der folgenden Herberge sollte mir solch ein Warmwasseraufbereitungsgerät von Wirlpool wieder begegnen. Da sie alle mehr oder weniger gleich konstruiert waren, fiel es mir ab jetzt nicht mehr schwer, ihre altertümliche Technik zu überlisten.
Nach dem Duschexamen trocknete ich mich wie zur Belohnung mit wunderbar flauschigen und nach Rosen duftenden Handtüchern ab und schlüpfte aufgewärmt in meine Ausgehkleidung: Jeans, T-Shirt, Wollpulli und Windbreaker. Den Zimmerschlüssel steckte ich in meine Umhängetasche zum Geld und meinen Dokumenten und verließ das Gästehaus so hungrig wie Fernradfahrer am Abend eben sind.
(Fortsetzung folgt)