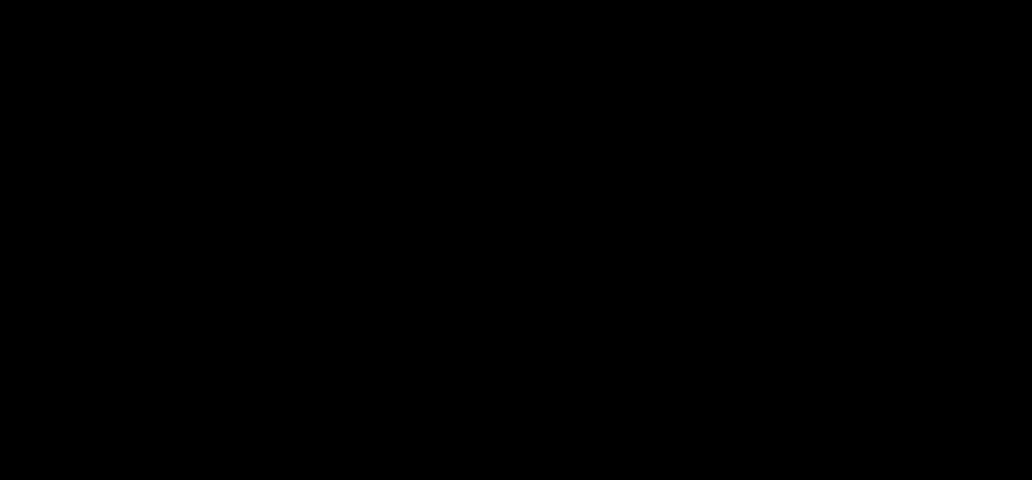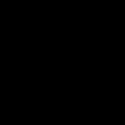Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 28)
Am späten Vormittag bog ich auf eine Zielgerade ein, eine aufgelassene Eisenbahntrasse, die schnurgerade auf Fort William zulief. Solche Trassen sollten mir noch öfters begegnen. Dabei kam es häufig vor, dass ich sonnengeblendet in das schwarze Loch eines Tunnels eintauchte und in der unbeleuchteten Höhle auf eiskalte Pfützen stieß, die ich auf wackeligen Reifen umfuhr, um bloß nicht tropfnaß wieder im Freien anzukommen.
Hinter einem Felshügel gabelte sich der Radweg: zwei Richtungen waren ab jetzt zu befahren. Diese Zweideutigkeit zwang mich zum Bremsen, Anhalten – und Studieren. Zwei Schilder verwiesen auf dasselbe Ziel, aber in unterschiedlicher Richtung. Jetzt war eine Entscheidung gefragt: Nach Fort William auf der Autostraße am Ostufer von Loch Linnhe entlang? Oder in Corran mit einer Fähre übersetzen und dem Westufer von Loch Linnhe folgen? Nach kurzem Überlegen entschied ich mich gegen den Trucker Trail, auf dem der Fernverkehr Glasgow-Inverness flutet. Somit entschied ich mich für ein Vabanque, denn anstelle von viel Verkehr sollte mich etwas Unvorhergesehenes erwarten, etwas Ungeahntes, das sich zu einer Prüfung auswuchs.
Mit abgebremstem Schwung das steile Ufer hinab, dann nichts wie rauf auf die eiserne Plattform der wartenden Pontonfähre, die wie ein Floß im Wasser lag und gerade mal Platz für vier PKWs bot. Eile war angesagt, denn die Fähre machte gleich nach mir die Leinen los. Auf ihrer Überfahrt transportierte sie außer mir und meinem kostenfreien Fahrrad nur einen Volvo Touring zum anderen Ufer hinüber. Das zehnminütige Übersetzen nutzte ich, um mich bis auf die kurze Radhose und das ärmellose Shirt aus dem Zwiebellook zu schälen. Im Windschatten herrschten bereits über 20 Grad, die das Abstreifen der schweißtreibenden Schichten verlangten.
Am anderen Ufer winkte ein Matrose in blauer Latzhose den schwarzen Volvo und mich mit meinem weißen Rad eine betonierte Rampe hoch. Dieser Mann kennt sich bestimmt aus, sagte ich mir und rief ihm gegen den Motorenlärm zu: „Hello Sir, ich will nach Fort William. Dafür brauche ich wohl noch eine zweite Fähre, wieder zurück über den Loch, nicht wahr?“
„Ja richtig, eine zweite Fähre brauchen Sie, diese überquert acht Meilen weiter unten die Enge von Loch Eil nach Fort William. Aber sie fährt nur zweimal am Tag.“
„Danke“, rief ich laut und beeilte mich, aus dem Motorenlärm und Dieselgestank fortzukommen. Im Laufschritt schob ich das Rad außerhalb der schwarzen Reifenspur auf dem Beton die Laderampe zur Straße hoch. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Poltern und sah mich im Gehen um. Mit einem gekonnten Satz war der Matrose mit einer Stahltrosse in der Hand auf die offene Plattform der bereits wieder zurückfahrenden Fähre gesprungen. Schade! Schon war er wieder fort, gerne hätte ich diesen jungen Schotten noch nach dem Fahrplan der anderen Fähre gefragt.
Gleich hinter den drei Hafenhäusern verabschiedete sich der gute Belag und ging in groben Schotter über. Für die nächsten Kilometer sollte er zum Sparringspartner meiner Waden werden! Grobkörniger, holpriger und knirschender Belag mag eine willkommene Herausforderung, ja, ein gefundenes Fressen für Stollenreifen auf Mountain Bikes sein, aber für meine schmalen Trekkingreifen begann nun eine Aktion zwischen Wühlen und Rutschen, eine Fahrt, die stabile Lenkarbeit und achtsames Balancieren erforderte. Ergeben schluckte ich meine Enttäuschung über den kräftezehrenden Kiesweg hinunter, weil ich für die Entbehrung einen Freifahrschein durch ein schottisches Arkadien einlöste.
Die Landschaft, die ich nun querte, hätte nicht stiller, nicht verträumter, nicht unberührter daliegen können. Vollkommen losgelöst vom Verkehr und ohne den geringsten Menschenlärm gelangte ich bald auf festgefahrenen Sand und vorwärts ging es wie von selbst. Nach drei Kilometern dann die erste Überraschung.
Hinter einem Wäldchen aus Buchen, Eichen, Eiben und Douglasien baute sich der Wächter von Fort William hoch über dem Wasserspiegel auf. Aus der Entfernung betrachtet stand der Berg wie ein monumentaler Stuhl gegen die saphirblaue Sphäre, ein steinerner Stuhl, dessen Sitzfläche aus einem klobigen Vorberg und dessen Lehne aus einem schlanken Gipfelaufbau bestand. Der Steinstuhl trug über seinem Basaltsockel einen Überwurf, eine Husse, die war bastbraun und mit zartgrünen Einwebungen geschmückt. Knapp unter dem Gipfel, der wie kein zweiter den Himmel über dem englischen Königreich erklimmt, erkannte ich in der klaren Luft abschüssige Kare voller Altschnee. Der Winter auf dem 1345 m hohen Ben Nevis war demnach noch nicht allzu lange vorüber.

Der Raum, den ich jetzt schneckengleich durchmass, hätte nicht archaischer sein können: Ben Nevis in der Höhe des Himmels, Loch Lynnhe in der Tiefe der Erde dicht neben mir. In ihrem urzeitlichen Gegensatz bildeten sie ein Paar seit Millionen von Jahren. Der Berg, ein erloschener Vulkankegel, der Loch, eine von Gletschereis gefräste Wasserrinne. In dieser Kombination entdeckte ich ein so perfektes Gleichgewicht, dass ich auf dem Lehrpfad durch die Natur bescheiden wurde. Im einsamen Dahinfahren öffnete sich mein Blick auf die zart getuschten Farben ringsum und die Nase umspielte der Duft der sprießenden Farne, Blätter und Blüten.
Jäh werde ich aus dem Verträumtsein gerissen, als vor mir auf der Piste ein Lämmlein im Schotterbett liegt und nicht wie sonst beim Heranfahren ängstlich wegspringt. Langsamer werdend stoppe ich dicht neben dem Wollknäuel. Aus nächster Nähe erkenne ich, dass das Babytier vor Angst am ganzen Körper zittert. Hat es sich ein Beinchen gebrochen oder sonst wie verletzt? Schon kommt die Mutter angestelzt und blökt: „Lass mein Kind in Ruhe.“ So zumindest lege ich ihr Blöken aus.
Das Lamm blutet nirgends, zumindest sehe ich nirgendwo Blut. Hat es sich vielleicht eine innere Verletzung zugezogen? Oder ist es mit einer ansteckenden Krankheit infiziert? Gibt es bei Schafen so etwas wie eine virale Infektion, eine Art Schafspest, vergleichbar der Schweinepest? Diese Überlegungen sind durchaus angebracht, denn unterwegs sah ich öfters tote Schafe auf den Weiden liegen. Soll ich das zitternde Lamm in Ruhe – und aus Angst vor einer Ansteckung – in seinem Elend liegen lassen? Es einfach auf der Piste, auf der ab und an auch Autos fahren, liegen lassen, nein, das würde mir das Herz brechen. Nun, ich trage Radhandschuhe und habe keine Schürf- oder Kratzwunde an den Händen, warum also nicht das kranke Tier anfassen?
Keine drei Meter entfernt blökt die Mutter aus vollem Hals und schaut mich aus geschlitzten Pupillen grimmig, aber auch verzweifelt an. Der Brustkorb ihres Kindes pumpt und bebt, instinktiv will es vor dem Zweibeiner fliehen. Aber sein erbärmlicher Zustand schwächt es zu sehr, um auf die Beine zu kommen. Nun bin ich kein Tierarzt, der ein krankes Lamm kurieren könnte, aber ich kann verhindern, dass es von einem heranbrausenden Auto angefahren oder im schlimmsten Fall überfahren wird.
Am Bauch hebe ich es vorsichtig hoch und lege es am Wegrand ins Gras. Bevor ich wieder in den Sattel steige, hole ich aus der Proviantdose einen Keks, den ich zerbreche und dem zitternden Tier vor die Schnauze lege. Nach einigen beruhigenden Worten fahre ich weiter und langsam kehrt im Kopf wieder Ruhe ein. Auf seltsame Weise beeinflusst – womöglich durch den Zusammenprall von krank & gesund, von verängstigt & forsch – überkommen mich elementare Gedanken über Sinn und Sinnlichkeit im Fortbewegen auf zwei Rädern.
Dieses spezifische Fahren ist etwas Elementares, im Kern ist es ein Balancieren. Und Balancieren hat mit Geschmeidigkeit, mit entkrampftem Rollen zu tun, mit einem Gefühl, als ob man einen sanft geneigten Wiesenhang bäuchlings abwärts rollt. Zwar unterliegt der Körper nach wie vor der Bodenhaftung, aber die Last durch die Schwerkraft, die ihn beim Gehen hemmt, fällt über der spielerischen Bewegung viel weniger ins Gewicht. Radfahren kommt einem Schwebezustand knapp über dem Boden gleich, der ein wohliges Gefühl vermittelt, ein Gefühl, das uns über die Beschränktheit des fußfordernden Gehens erhebt und recht schnell, bereits nach drei, vier kräftigen Pedaltritten, die Illusion des Fliegens aufkommen lässt.

Als sich hinter meiner Stirn solche Einsichten formten, überkam mich inmitten der Einsamkeit eine erstaunliche Leichtigkeit und schnell hatte ich das kranke Lamm vergessen. Im weiteren Fahren wurde mir bewusst: In dem Maße wie meine Fahrt durch die freie Natur die Oberhand über mein Empfinden gewann, in dem Maße verlor ich jegliche Lust an der Zielorientierung.
Über fünfzig Jahre des Experimentierens mit allen möglichen Arten der Fortbewegung liegen hinter mir: Mit schnellen Mitteln, zum Beispiel auf einem schweren Motorrad, im Sportwagen oder auf Skis, aber auch mit langsamen Methoden wie Wandern, Nordic Walking und Joggen. Viele Versuche habe ich gestartet, bis ich die Einsicht gewann, dass es ein Nichtbewegen im Bewegen gibt, einen Zustand der nur intuitiv und nicht willentlich erreicht werden kann. Dabei handelt es sich um einen Zustand, den die Musik am bestens wiedergibt. Es ist wie wenn eine Melodie erklingt und alle plumpen Geräusche ersterben, weil alle Zuhörer den Atem anhalten und lauschen. Diese magische Atemlosigkeit ist für mich der Flow, ein Zustand, der Sinn und Zweck, ja selbst das Ziel am Ende des Vorwärtskommens zweitrangig werden lässt.
Über den Flow wird unter Sportlern viel gerätselt, und von Esoterikern wird er als Einswerden mit den vier Elementen, die immer im Fließen sind, definiert. Aber sieht man im Flow nur das Fließen mit den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer, dann hat man zwar seine energetische aber nicht seine ethische Bedeutung erfasst, denn er ist auch ein Verzicht auf das Begehren, auf den Drang, etwas zu erreichen oder zu bekommen. Dabei ist das schiere Begehren nicht förderlich, im Gegenteil, es bringt Unglück hervor. Nein und nochmals nein! Begehren ist keine harmlose Leidenschaft, Begehren ist die kleine Schwester der Begierde, die uns alle als Tochter der Gier bedrängt.
Wer als Radfahrer oder Fußgänger der Langsamkeit frönt, kann leichter auf das zielorientierte Begehren verzichten als ein Automobilist. Allerdings bedeutet der Unterschied qua Vehikel noch lange nicht, dass ein Radfahrer oder Läufer zwangsläufig ohne Begehren ist. Vielmehr kommt es auf seine Einstellung zu Weg und Ziel an. Gerade bei stundenlangem Dahinfahren auf dem Rad ist das Verlangen, ans Ziel zu kommen, bevor die körperlichen Kräfte versagen, nur schwer beherrschbar. Wie schwer, das sollte ich schon bald erleben.
Die Sonne stand cremegelb im Zenit, als ich bei lockerem Pedalieren am Landungssteg der zweiten Fähre ankam, dort, wo sich das Wasser von Loch Linnhe mit dem von Loch Eil vermischt und eine brüske Barriere vor der gegenüberliegenden Uferstadt Fort William bildet.
Wie aufgelassen lag die Haltestelle da, weit und breit war keine Fähre zu sehen. Enttäuscht lief mein Blick das steile Ufer hinab und einen in die Jahre gekommenen Brettersteg entlang, der wie abgebrochen im verschlickten Wasser endete. An seinem Eisengeländer hing eine verwitterte kleine Tafel, die einen vergilbten, eher in ein Antiquariat als an eine intakte Haltestelle gehörenden Fahrplan enthielt. Um 5.00p.m. sollte nach dem sonnen- und regengegerbten Plan die nächste Fähre über den Loch nach Fort William abfahren. Aber war diese Ansage noch gültig? War der Aushang aktuell oder nur noch ein vergessenes Zeichen aus besseren Zeiten? So verwahrlost wie Steg und Fahrplan aussahen, stimmte mich die Sache skeptisch. Ich rang mit mir und immer wieder sah ich hinüber, sehnsüchtig und auf ein Wunder hoffend. Unschlüssig über mein weiteres Tun, versuchte ich mich in Gedankenspielen.
Sogar zum Himmel flehte ich: Hätte nur Christo seine Floating Piers am lacus eil und nicht am Lago d’Iseo installiert!In zehn Minuten wäre ich über das Wasser geradelt und Scharen von Wanderern und Bürgern hätten fröhlich über den gelben Steg in beiden Richtungen spazieren können. Aber es sollte nicht sein, Christo hatte für seine letzte Installation eine andere Location ausgesucht.
Unerwartet drang ein lauter werdendes Motorengeräusch an mein Ohr. Nahte die Rettung? Tauchte gleich eine außerplanmässige Fähre oder irgendein privates Bötchen zum anderen Ufer auf? Leider nein, das Ende der Stille kam nicht vom Tuckern eines Außenborders, sondern vom Knattern eines hochgezüchteten Motors. Schon sah ich aus einer Staubwolke einen Motorradfahrer auftauchen und rasch auf mich zukommen. Mit Handzeichen gab ich ihm zu verstehen, dass ich Hilfe brauchte. Tatsächlich ließ er vom Gas und stoppte dicht vor meinem abgestellten Fahrrad mit laufendem Motor. Während er das Helmvisier öffnete, sagte ich zu ihm: „Hello Sir! Fährt die Fähre nach Fort William wirklich? Um 5.00 p.m.?“
„Weiß ich leider nicht“, erwiderte er achselzuckend, aber nicht unhöflich.
Ich glaubte ihm, weil er unter dem schwarzen Helm sehr professionell aussah, und fragte nach: „Wissen Sie denn zufällig, wie weit der Weg um das Loch herum nach Fort William ist?“
„Naja, mit dem Rad schon ziemlich weit, neun Meilen an diesem Ufer hin und neun Meilen am anderen zurück, würde ich schätzen.“
„Wirklich?“
„Ja, man glaubt es nicht, weil man dort vorne schon das Ende zu sehen meint, aber das ist nur eine Halbinsel, dahinter geht es weiter. Loch Eil ist verdammt lang und so groß, dass er sogar einen eigenen Namen hat. Aber, ich kann Ihnen versichern, die Strecke am Ufer hat kürzlich einen guten Belag bekommen. Leider muss ich jetzt weiter, bye!“
Nochmals 29 Kilometer, überlegte ich und musste seufzen, während der Schotte von Motorenkraft beflügelt davonbrauste. Mein Tagespensum würde sich auf über 100 Kilometer addieren, immerhin war ich an diesem Tag bereits 70 Kilometer gefahren. Aber was blieb mir anderes übrig? Abwägend stand ich von Angesicht zu Angesicht dem gewaltigen Ben Nevis gegenüber, nur durch einen schmalen Wasserstreifen von der Zivilisation getrennt, deren sakrales und profanes Zentrum überdeutlich auszumachen war. Die Konturen der Kirche und des blockischen, fensterlosen Supermarkts hoben sich deutlich vom Häuserpuzzle der langgestreckten Uferstadt in Hanglage ab.
(Fortsetzung folgt)