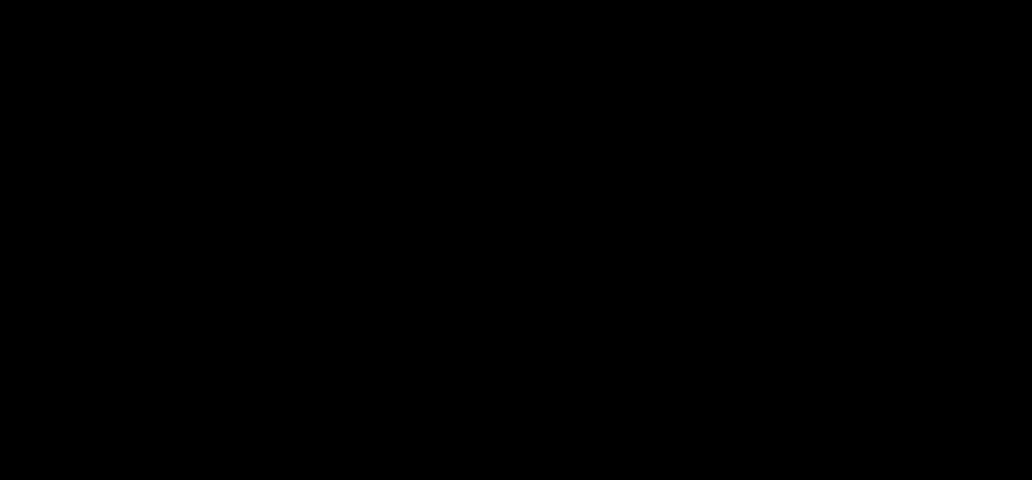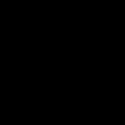Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv im auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.
Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).
Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist am 01.02.2021 im Alba Collection Verlag GbR erschienen. Es kann zum Preis von 19,- Euro hier vorbestellt werden.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 11)
Mit spontan geänderter Routenplanung stieg ich wieder in den Sattel und lenkte mein Rad auf die Straße, die ich gekommen war und deren traurigen Belag ich bereits kannte. Erneut folgte ich dem spiegelglatten Loch Indaal und erreichte nach drei Kilometern eine verschämt kleine Abzweigung, die mich landeinwärts lenkte. Bereits auf den ersten hundert Metern musste ich andauernd Felgenschläge abfedern, denn das Sträßlein entpuppte sich als besserer Feldweg, immerhin geteert. Allerdings war sein Patchwork Asphalt alles andere als hinternschonend, aber die Aussicht, die sich nach einem Kilometer auftat, sollte mich belohnen. Schon bald lenkte mich das Asphaltband durch bastbraunes Brachland einen tüchtigen Hügel hinauf. Wieder eine gute Gelegenheit, den Alkohol auszuschwitzen. Nach drei Kilometern musste ich aufgrund der Schlagloch-Parade Schlangenlinien fahren und fürchtete bereits um den Zustand der Vordergabel.
Ab jetzt wurde die Gegend immer einsamer und nur noch vereinzelt tauchten die rostigen Blechdächer von Farmgebäuden auf. An einem abgewrackten Hof kam ich so dicht vorbei, dass mich das Elend abgestellter Gerätschaften und ausgedienter Landmaschinen so flehend anbettelte, als verlangte es nach einer Spende. Ganz traurig wurde ich und machte mir bereits Sorgen um die schottische Landwirtschaft. Endlich lag die Steigung mit der Eschenallee hinter mir, schwer atmend hatte ich einen langgezogenen Hügelrücken erklommen. Während der kraftraubenden Auffahrt hatte ich schon meine spontane Routenänderung bereut, doch als ich in der Höhe angekommen und der Wadenkampf wieder zum Wadenvergnügen geworden war, freute ich mich über den Weitblick bis zum Atlantik. Ab jetzt ging es erhöht und flach oberhalb einer fellbraunen, bis zum Horizont rollenden Weidelandschaft in Richtung Meer. Für die Mühe wurde ich sogar ein zweites Mal belohnt, ab jetzt schob mich ein forscher Wind meinem Ziel entgegen.
Hier oben war die offene Weite menschenleer, sprühte aber trotzdem vor Leben: Tausende und Abertausende von weißen Wollknäueln, die Tag und Nacht im Freien lebten, bevölkerten die Weiden bis tief in den Horizont hinein. Weit entfernt von einem kitschigen Postkartenmotiv blickte ich auf ein Aquarell der Farben Grün, Braun und Blau, die von der Steinmauer zu meinen Füßen bis in den tiefen Horizont hineinflossen, so tief, dass mir die windbewegte, klare Luft eine gewaltige, kilometerweite Aussicht in den Horizont hinein erlaubte.
Zu meinen Füßen war das Grün noch trocken gelb, in der fernen Senke hingegen schon vorwitzig grün und am Hang dahinter versöhnlich braun. Dieses weitentfernte, zerfließende Braun umspannte einen blauen Spiegel, der Loch Gorm hieß. Als mein Blick weiter vordrang, den braunen Hang hinauf und noch tiefer in den Horizont hinein, erspähte er hinter einem weißen Streifen wieder einen Spiegel, nur dass dieser nicht glatt, sondern geriffelt und smaragdgrün in der Landschaft lag und einen Namen trug, den jeder kennt: Atlantik. Zu guter Letzt, noch tiefer im Horizont, zerfloss dieses Smaragdgrün mit einem grenzenlosen Blau, belebt von Wattetupfern. Ich musste anhalten, ein Foto schießen und die Palette der Islay Farben festhalten. Ich musste dieses Bild, das ich von der Camargue, nicht aber von Schottland erwartet hätte, als Beweis dokumentieren.
Wer durch Schottland reist, wird der Farbe Braun, die bei uns unter einem schlechten Image leidet, mit neuem Respekt begegnen, denn sie ist alles andere als plump und einheitlich, nein, sie kennt viele feine Töne und ist von uralter Geburt, schmückte sie doch bereits die eiszeitliche Erde.
Noch immer schob mich ein wohlwollender Wind das Sträßlein auf dem Hügelrücken entlang und dem Ziel meines Abstechers entgegen – einem Pagodenturm, einem metallic glänzenden Silo und einem langgestreckten weißen Gebäude, hinter dem eine rotbraune Felsklippe in den Himmel wuchs. Auf dem letzten Abschnitt überholten mich überaus rücksichtsvoll Autos und sogar Busse im Schritttempo. Anscheinend war der Radler hier willkommen, denn als ich am Schild „Rockside Farm“ vorbeifuhr, wurde ich von einem tausendfachen „Mäh“ begrüsst. Schafe, diesmal erstaunlich zahme Artgenossen, drängten sich im Pulk an das Gatter und beäugten das nicht alltägliche Vehikel mit einem Menschen obendrauf. Dieses nicht alltägliche Vehikel hatte hier und immer wieder den großen Vorteil, dass ich auf ihm so dicht wie kein Automobil an das Visitors Center einer Destillerie heranfahren konnte. Autos, Wohnmobile und Busse mussten auf vorgeschriebenen Parkplätzen in der Entfernung abgestellt werden. So wollte es die Regel in allen Whiskybrennereien, auch auf der Rockside Farm. Und daran hielt sich auch jeder.
Privilegiert lehnte ich mein bepacktes Rad an die Ziegelmauer direkt neben dem Eingang und schloss es vorsichtshalber ab. Allerdings verzichtete ich darauf, meine verschwitzte Funktionswäsche auf der Toilette zu wechseln, auch die beiden Taschen schnallte ich nicht ab. Lediglich die Umhängetasche mit meinen Wertsachen warf ich mir über die Schulter und trat wieder einmal in Radklamotten durch die Tür, diesmal in das Kilchoman Café.
Alle Achtung, verdammt chic das Ganze, entfuhr es mir, als ich die ersten zögernden Schritte auf dem Dielenboden unternahm. Edle Holztäfelung und dezent illuminierte Fotografien entlang der Wände. In einem Seitentrakt reihten sich Glasvitrinen auf, in denen die Brennerei ihre edlen Tropfen präsentierte. Ich hätte schwören können, hier war ein Innenarchitekt am Werk, der sich in Skandinavien umgesehen hatte. Der Verkaufstresen, die Vitrinen, die Wanddekoration und auch die obligatorischen Vermarktungsprodukte vom Kilchoman-Schal bis zum Kilchoman-T-Shirt, alle made in China, waren einheitlich von der keltischen Ikonographie geprägt. Natürlich auch die edlen, bauchigen Flaschen der beiden Renner: Machir Bay und Sanaig.
Bevor ich mir ein Tasting gönnte, legte ich mir erst einmal ein Magenpolster zu, eine Tomatensuppe mit Brotbegleitung, die so sämig im Teller lag und so wundervoll schmeckte, dass sie meinen Radhunger restlos stillte. In der Vergangenheit ein Suppenkaspar, mutierte ich auf dieser Fahrt zum Suppenfan, denn außer dem Single Malt ist die Suppenküche eine weitere geniale Errungenschaft der Schotten. Kaum hatte ich mit einer Kilchoman Serviette die roten Lippen abgewischt, ließ ich mir auf eigene Kosten einen achtjährigen Machir Bay am Tisch servieren.
Die Augen sahen Bernstein, die Nase erschnüffelte viel Torf, abgelöst von Spuren von Vanille, schwarzem Pfeffer, Salz, Tang und Leder. Allerdings erschnupperte sie auch noch einen Nachzügler, ein Quentchen süßer Frucht dank eines mehrmonatigen Ausbaus im Ex-Olorosa Sherryfass. Nach dem Nosing legte ich einen kleinen Schluck Machir Bay unter die Zunge – was den Mundraum regelrecht erschreckte. In praller Fülle wurde er von geräuchertem Speck und Röstaromen bis in den hintersten Winkel okkupiert, was es den Fruchtnoten ungemein erschwerte, ihre Süße zu entfalten. Im rauchgeschwängerten Abgang dominierte eine trockene Note Nuss, die ich so noch nicht erlebt hatte. Dem Torfliebhaber mag der Machir Bay 46 % vol. eine Offenbarung sein, auf meiner Skala konnte er nur mit zwei Stützrädern punkten. Zweifelsohne war die schöne Nuss am Gaumen eine Novität, aber der kurze Abgang wurde von einem allzu ledrig-holzigen Nachhall dominiert.
Eigentlich hätte ich im seitlich angegliederten Vitrinenraum noch den Sanaig probieren sollen, aber als ich aus dem großen Giebelfenster blickte, schoben sich schwarze Regenwolken auf den Roten Felsen zu. Siedend heiß fiel mir plötzlich wieder ein, dass ich heute noch 30 Kilometer fahren müsste, um die Fähre von Port Askaig nach Kennacraig zu bekommen. Kurz entschlossen entschied ich mich gegen das Bleiben im skandinavischen Ambiente. Der beliebte Sanaig, ein getorfter und in Ex-Bourbon und Ex-Sherryfässern gereifter Kilchoman, verdiente eine gewissenhafte Verkostung, aber dafür fehlte mir plötzlich die Muße, denn in kürzester Zeit hatte sich der Himmel über der Rockside Farm pechschwarz zugezogen.
Von einer inneren Unruhe getrieben, beeilte ich mich ins Freie zu kommen und mit fahriger Hand öffnete ich das Kabelschloss am Rahmen. Sollte ich den Anorak jetzt schon überziehen, oder erst, wenn der Regen einsetzte? Noch war ich unerfahren, was die örtlichen Wetterkapriolen anging. Allerdings war ich auch kein deutscher Wetternörgler. Bereits zu Reisebeginn, auf der Fahrt von Edinburgh nach Glasgow, hatte ich registriert, dass selbst ein Himmel mit tiefhängenden, schwarzgrauen Wolkenmonstern nicht unbedingt Regen bedeuten musste. Meistens zerriss ein tüchtiger Wind die Wolkendecke und verhalf zumindest einigen Sonnenstrahlen für kurze Zeit zum Durchbruch. Es konnte dann tröpfeln, aber das musste noch kein Weltuntergang sein.
Nach kurzem Überlegen ließ ich die Regenbekleidung im Gepäck und trat die Rückfahrt wieder über dieselbe Hügelroute an. Als sich erneut die grünbraune Senke mit Loch Gorm ins Blickfeld schob, kam mir die Landschaft jetzt viel weniger spektakulär vor, viel eher wie ein beliebiger Landstrich. Verwunderlich, dachte ich beim flüchtigen Blick. Doch als ich länger hinüber blickte und überlegte, fand ich des Rätsels Lösung: das Licht! Es war das verschwundene Sonnenlicht, das zuvor den Blick verzaubert hatte! Das Licht der Sonne hatte zwei Stunden zuvor die sanftgewellte Weidelandschaft mit einem Zauberpinsel übermalt und das Faszinosum einer Turner-Landschaft geschaffen.
Auf halbem Weg baute sich vor meinem Vorderreifen ein blind summit auf, hinter dem sich ein entgegenkommendes Fahrzeug hätte vollständig verbergen können. Ich musste Acht geben, denn die Ausweichmöglichkeiten auf der schmalen Kilchoman Zufahrt waren auf drei, vier passing places beschränkt. Schwer atmend schaffte ich den ersten Anstieg. Von oben bot sich dann ein freier Blick auf ein leeres Asphaltband, das sich sanft abwärts zur Hauptstraße schlängelte. In einer Rechtskurve drehte ich mich nochmals um, Kilchoman war in einer Senke verschwunden und der rote Fels zeigte sich nur noch als Hubbel, den ein schwerer Wolkenhimmel niederzudrücken schien. Schneller als erwartet, erreichte ich wieder die Uferstraße um den Loch und eine halbe Stunde später wieder das triste Straßendorf Bridgend. Am Spar-Laden stoppte ich diesmal nicht, sondern bog mit Tempo gleich auf die belebte Verkehrsader nach Port Askaig ein.
Inzwischen schaute der Himmel grimmig auf das radelnde Männlein herab, das der Nordspitze von Islay entgegenstrampelte und ab und an zu ihm hinaufschielte. Kurz hinter Bridgend schlug diesem strampelnden Wicht eine Böe ins Gesicht, als wollte sie ihm die Flucht von der Insel verwehren. Aber das Radmännlein gab nicht klein bei, sondern trat um so heftiger in die Pedale. Sofort änderte der Wind seine Taktik und schoss von der Seite daher, als wollte er das Rad zum Kippen bringen. Wäre ich freihändig gefahren, wäre ich definitiv im Graben gelandet. Reflexartig packte ich den Lenker mit Kraft und beugte windschnittig das Kreuz. Ich musste mich sputen, noch waren es 20 Kilometer bis Port Askaig, wo die Fähre zum Festland ablegte.
Finster war es geworden und die Wolkendecke hing tonnenschwer über den dunkelgrünen Weiden mit ihren tausenden Schafen, deren Wollkleid vor dem tintenschwarzen Himmel wie angestrahlt leuchtete. Als wären sie motorisiert, drängten immer neue Wolkenwalzen auf mich zu und senkten sich regenschwanger tiefer und tiefer. Die Schafe kümmerten sich nicht um das Himmelschauspiel, ihre langen Köpfe sahen nur das sprießende Grün vor ihren rosigen Schnauzen. Da mir ihr dichter Winterpelz fehlte, schielte ich immer wieder nach oben – sollte ich anhalten und die Regensachen überziehen oder ohne Halt schneller weiterfahren?
Mir war bewußt, dass ein Anorak und eine Überhose mit verschweißten Nähten wie eine Plastiktüte wirkt, nämlich die Haut darunter schnell und heftig ins Schwitzen bringt. Im Nu ist man unter der Kleidung so klatschnass, als wäre man nackt durch den Regen geradelt. Kurzum, ich blieb im Sattel und fuhr mit Tempo weiter. Keine zehn Minuten später wurde mir die Rechnung vom Himmel präsentiert.
Urplötzlich schossen heftige Regensalven aus den schwarzgrauen Wolken hervor und zwangen mich auf der Stelle abzubremsen. Zum Glück hatte ich beim Packen am Morgen den Wetterumschwung bedacht und den Anorak und die kurze Überhose nach oben auf die „Abendkleidung“ gelegt. Harsch bremsend hielt ich an und riss den Klettverschluss der roten Satteltasche auf und keine zehn Sekunden später hatte ich den Anorak übergestreift und war mitsamt der Turnschuhe in die kurze Überhose gestiegen. Nun war ich bis auf die Turnschuhe und die weißen Streifen am Helm in Schwarz gekleidet und konnte nur hoffen, dass mich keiner im Straßenverkehr übersah. Dieses Hoffen war nicht aus der Luft gegriffen, denn das Gebaren auf Islays Straßen war um einiges rabiater als im Rest von Schlottland – auf Islay regierte die Devise „time is money“.